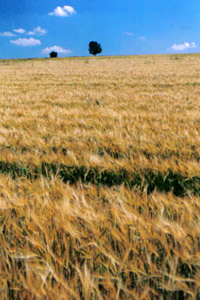|
|
 |
 |
|
Geomantie und Kraftorte, Genius Loci
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Der Geist eines Ortes - Kleine Kulturgeschichte des Genius Loci
Von Robert Kozljanic
Genius Loci - der Geist eines Ortes: ein traditionsreiches Wort für ein traditionsreiches Phänomen. Von der Antike bis heute: immer wieder taucht dieses Wort auf, immer wieder nimmt man darauf Bezug, immer wieder will man damit etwas sagen, will damit auf gewisse Phänomene hinweisen. Besonders in den letzten Jahrzehnten, im Zuge der nicht abebbenden umwelt- und naturbezogenen Diskussionen, erfuhr dieser Begriff eine regelrechte Renaissance. Der folgende Text, das Manuskripts eines Vortrags, untersucht die Herkunft des Begriffs und seine wechselnde Bedeutung im Laufe der Epochen bis in die heutige Zeit.
Der Mythos lebt. Er wurde nie vom Logos überwunden, wenn überwunden meint: getötet. Wenn wir sagen: "Schau! Dort! Die Sonne geht unter. Schön, nicht?" - dann ist der Mythos da.
Der Logos kann den Mythos überformen und überbauen, verplanen und planieren, verstellen und verdrängen - selbst zubetonieren - nie aber ausmerzen.
Die wissenschaftliche Erklärung mag uns (auf der Basis des Logos, wie sich versteht) immer und immer einhämmern: dass nicht die Sonne es ist, die untergeht, sondern nur dieser Fleck Erde hier sich soeben aus der Sonne dreht; dass die Sonne weder gehen noch untergehen kann: sie hat nämlich keine Füße; und - zu guter Letzt - was heißt hier schön? Alles Anthropomorphismen, Die Realität (des Logos, wie sich versteht) sieht anders aus.
Doch diese Erklärung ändert nichts daran, dass auch morgen die Sonne wieder untergehen wird. Schön, nicht?
Ein Beispiel, an dem man ebenfalls sehr gut sehen kann, dass der Mythos durch den Logos nicht auszumerzen ist, ist die Geschichte des Begriffs und Phänomens des Genius Loci.
|
|
|
|
|
|
|
Genius Loci - der Geist eines Ortes: ein traditionsreiches Wort für ein traditionsreiches Phänomen. Von der Antike bis heute: immer wieder taucht dieses Wort auf, immer wieder nimmt man darauf Bezug, immer wieder will man damit etwas sagen, will damit auf gewisse Phänomene hinweisen. Besonders in den letzten Jahrzehnten, im Zuge der nicht abebbenden umwelt- und naturbezogenen Diskussionen, erfuhr dieser Begriff eine regelrechte Renaissance.
Der in verschiedenen Disziplinen (v.a. Architekturtheorie, Humangeographie, Garten- und Landschaftgestaltung, aber auch Esoterik, Geomantie und Radiästhesie, Religionwissenschaft, Archäologie, Literaturwissenschaft etc.) immer wiederkehrende Terminus des Genius Loci erweckt auf den ersten Blick den Eindruck, man hätte es dabei stets mit den gleichen Begriffen, Ansätzen und Phänomenen zu tun. Doch der Schein trügt. Es handelt sich um verschiedene Diskurse, die jeweils unter Genius Loci etwas anderes verstehen. Die Palette dessen, was Genius Loci sein soll, reicht dabei von der rein metaphorischen und rhetorischen Bedeutung des Wortes, über die geschichtliche eines an einem Ort erscheinenden "Zeitgeistes" und eines soziokulturell konstruierten "Ortsgeistes", ferner über die Bedeutungen von ökologischen, ästhetischen und synästhetischen Qualitäten von Orten, bis hin zu ortsgebundenen "Energiefeldern" und "ortsansässigen" Naturgeistern. Diesen verschiedenen, teils widersprüchlichen Bedeutungen des Begriffs Genius Loci scheint mir aber doch ein gemeinsames Motiv, ein umgreifendes Bedürfnis zugrundezuliegen. Dieses Bedürfnis scheint das zu sein, der zunehmenden Heimatlosigkeit unserer Zeit - einer Heimatlosigkeit, die, wie Heidegger in seinem Vortrag "Bauen Wohnen Denken" 1951 betonte im Grunde eine Ortslosigkeit ist - entgegenzusteuern. Dieses Bedürfnis, dunkel und unausmerzbar wie es ist, ist mythisch. Man kann es nicht auf den Begriff bringen. Von daher kann man es auch nicht ideologisch ausbeuten. Genauer gesagt: nur das begrifflich zurechtgemachte Derivat jenes Bedürfnisses läßt sich ausnützen, nicht aber das Bedürfnis selbst.
Um dem Begriff, aber auch dem Phänomen des Genius Loci näher zu kommen, um überhaupt einmal festzustellen und festzuhalten, was man in der Antike, aus der dieser Begriff ja stammt, damit meinte und welche Erfahrungen man damit verband, möchte ich zunächst einen Blick auf den archaisch-mythischen Ursprung des Genius Loci werfen:
|
|
|
|
|
|
|
1. Der archaisch-mythische Ursprung des Genius Loci
1.1 Zum Begriff des Genius Loci in der Antike
In der Antike war man generell der Ansicht, dass speziellen Orten spezielle Ortsgeister, Ortsgenien, einwohnen würden. Vor allem handelte es sich hierbei um artifizielle Orte, denen eine soziale und existenzielle Bedeutung zukam, oder aber um natürliche Orte, die von sich her eine gewisse göttliche oder, besser, numinose Ausstrahlung hatten.
In Bezug auf den künstlichen Ort und seinen Geist lesen wir bei Prudentius: ". . . auch den Thoren pflegt ihr einen Genius zuzuschreiben, den Häusern, den Thermen, den Ställen und für jeden Ort und alle Glieder der Stadt viele tausend Genien anzunehmen, so daß kein Winkel des ihm eigenen Schattengeistes entbehre."
Und in Bezug auf den natürlichen Ort sei eine interessante Stelle bei Cato, in dessen Schrift über die Landwirtschaft, angeführt: "Einen Hain muß man nach römischem Brauchtum so auslichten: Bringe mit einem Schwein das Sühneopfer dar, sprich folgende feierliche Formel: Ob du ein Gott bist oder eine Göttin, demgehörig dieses Heilige ist, wie es Recht ist, dir mit einem Schwein das Sühneopfer zu bringen der Lichtung jenes Heiligtums halber und dieser Dinge halber, daß es mit Recht getan sei, mag ich, mag es irgendeiner auf meinen Befehl tun, dieser Sache halber richte ich, indem ich dieses Schwein zum Sühneopfer schlachte, gute Bitten an dich, daß du seiest gütig und geneigt mir, meinem Hause, meiner Hausgenossenschaft und meinen Kindern; dieser Dinge halber sei geehrt durch Schlachtung dieses Schweins zum Sühneopfer."
Oft hatten die Ortsgenien einen eigenen Altar, auf dem ihnen geopfert wurde. Ein herculanensisches Wandgemälde gibt einen Eindruck davon.
Dem Begriff des Genius entspricht im Griechischen der des "daimon". Daimon bedeutet in der Antike nicht Teufel oder teuflischer Geist - diese Bedeutung bekam er erst durch die christliche Uminterpretation - sondern daimon meint einfach ein numinoses Wesen, einen göttlichen Geist. Göttliche Wesen gab es viele, einige darunter waren bei den Griechen ortsgebundene Lokaldaimonen. Wenngleich die Griechen für diese Lokaldaimonen - im Gegensatz zu den Römern - auch keinen eigenen Begriff hatten, daran, dass an speziellen Orten spezielle göttliche Wesen hausen, war kein Zweifel. Wenn z.B. Sokrates im platonischen Dialog "Phaidros" in unmittelbarer Nähe eines am Illissos-Fluss gelegenen Nymphenheiligtumes sagt: "Denn in Wahrheit göttlich scheint dieser Ort zu sein, so daß, wenn ich gar im Verlauf der Rede mehrfach von den Nymphen ergriffen werde, du dich mir nicht wundern mögest", so meint er damit nichts anderes, als dass es hier ortsansässige, göttliche Geister gebe, deren Einfluss er an diesem Ort ausgesetzt ist. Doch damit habe ich schon einen weiteren Punkt angesprochen:
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Das mythisch-archaische Erleben des Genius Loci
Genius Loci war ja nicht nur ein Begriff, der in der Antike verwendet wurde, war ja nicht nur eine gewisse - mehr oder weniger reflektierte, mehr oder weniger verbreitete - Ansicht über Ortsgeister. Vor allem verbanden sich mit diesem Begriff gewisse lebensweltliche und religiöse Erfahrungen und Erlebnisse. Diesen möchte ich mich nun zuwenden, um das archaisch-mythische Phänomen, also die lebensweltliche Erscheinung des Genius Loci näher in den Blick zu bekommen. Das obige Platon-Zitat hat es schon angedeutet: an gewissen Orten findet man eine numinose Atmosphäre vor, eine gewisse geheimnisvoll-göttliche Stimmung, eine Anmutung, die einen auch in ihren Bann ziehen kann. Damit ist eine zentrale antike Genius-Loci-Erfahrung angesprochen, die von Seneca im 41. Brief an Lucilius noch deutlicher gefasst wurde
"Wenn du findest einen von alten und über die übliche Größe hinausgewachsenen Bäumen bestandenen Hain, den Anblick des Himmels durch den Wuchs einer den anderen verdeckender Zweige verhindernd - diese Erhabenheit des Waldes, das Geheimnisvolle des Ortes (secretum loci) und die Verwunderung über den in einer offenen Landschaft so dichten und ununterbrochenen Schatten wird dies in dir den Glauben an göttliches Walten (an das Numinose: numinis) wecken. Wenn eine Höhle, tief aus den Felsen ausgewaschen, den Berg über sich trägt, nicht von Menschenhand geschaffen, sondern durch Kräfte der Natur zu solcher Weite ausgehöhlt, wird sie deine Seele durch eine Ahnung von Gottesfurcht erbeben lassen. Bedeutender Flüsse Quellen verehren wir; das unvermittelte Hervorbrechen eines starken Stromes aus dem Verborgene besitzt Altäre; verehrt werden die Quellen heißer Gewässer, und manche Seen hat entweder schattiges Dunkel oder unergründliche Tiefe geheiligt." Ich möchte dieses Erleben als das stimmungsmäßige Erleben eines Ortes bezeichnen. Ort wird hier im archaisch-mythischen Kontext wohlgemerkt immer als relativ eng umgrenzter Bezirk verstanden: dieser Hain, diese Quelle, dieser See, dieser heilige Baum, diese Stelle des Berges, etc.
|
|
|
|
|
|
|
Um einen Einblick in die tiefsten Schichten des Erscheinens des Genius Loci zu geben - einen Einblick in das, was ich in Folge daimonisches Erleben eines Ortes nennen werde - möchte ich mich kurz dem bis in graue Vorzeit zurückweisenden Trophonios-Orakel zu Lebadeia in Böotien zuwenden. Pausanias hat in seiner"Beschreibung Griechenlands" (2. Hälfte des 2. Jh. n. Chr.) eine eindrückliche Schilderung der rituellen Orakelbeftagung des dortigen Höhlendaimons Trophonios gegeben. Laut Pausanias muss der Orakelsuchende, nach tagelangen rituellen Vorbereitungen, Fasten, Opfern, in der durch Eingeweideschau ermittelten günstigen Stunde in Leinengewand gehüllt, mit einheimischen Sandalen an den Füßen, zur Höhle des Trophonios gehen. Mit den Füßen voraus lässt er sich in den engen Höhlenspalt gleiten.
Hören wir, an der interessantesten Stelle, Pausanias selbst: "Der übrige Körper wird dann sofort ergriffen und folgt den Knien nach, wie der größte und reißendste Fluß einen vom Strudel erfaßten Menschen verschlingt. Von da an ist für die, die in das Allerheiligste gelangt sind, die Art und Weise, wie sie die Zukunft erfahren, nicht ein und dieselbe, sondern der eine sieht, der andere hört etwas. Die Hinabgestiegenen kehren durch dieselbe Öffnung wieder zurück und wieder mit den Füßen voraus. ... Denjenigen, der vom Trophonios heraufkommt, nehmen wieder die Priester und setzen ihn auf den sogenannten Thron des Erinnerns, der nicht weit vom Allerheiligsten steht, und fragen ihn dort, was er gesehen und erfahren hat. Danach überlassen sie ihn seinen Angehörigen. Diese tragen ihn in das Haus, in dem er sich auch vorher aufhielt bei dem guten Geschick und dem guten Daimon, noch ganz benommen vom Schrecken und ohne Bewußtsein seiner selbst und seiner Umgebung. Im übrigen ist er dann später durchaus nicht weniger bei Verstand als vorher, und das Lachen kommt ihm auch wieder. Ich schreibe das nicht nur vom Hörensagen, sondern weil ich andere gesehen und auch selber das Orakel des Trophonios befragt habe. "
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Das mythisch-archaische Einordnungsverhältnis
Will man die Beziehung, in der der mythisch-archaische Mensch hier zur Natur steht, mit einem Wort beschreiben, könnte man treffend von einem Einordnungsverhältnis sprechen. Der Mensch ordnet sich dem natürlich-numinosen Ort, den er schon in seiner gewachsen und natürlich gewordenen, sozusagen bodenständiger Struktur antrifft unter, bzw. ein. Die natürliche Grotte wird bestenfalls etwas ausgemeißelt, nämlich um ein Kultbild des Genius Loci hinzustellen; der Hain wird höchstens mit einer Einhegung versehen, nämlich um ihn vom profanen Außen abzugrenzen; am Berg stellt man einen kleinen Rundaltar auf. Aber alle gestaltenden Eingriffe des Menschen ordnen sich im Prinzip dem Vorgefundenen ein, geben sich den natürlich-numinosen Einflüssen hin.
|
|
|
|
|
|
|
2. Die mythisch-homerische landschaftliche Ausweitung des Genius Loci
2.1. Das mythisch-homerische Überformungsverhältnis
"Es ist", schreibt Erwin Rohde, der berühmte Altphilologe und Freund Nietzsche, "wenn man nur Homer vertrauen wollte, als ob die zahllosen Lokalkulte Griechenlands, mit ihren an einen engen Wohnplatz gebundenen Göttern , kaum existiert hätten: Homer ignoriert sie fast völlig. Seine Götter sind panhellenische, olympische. ... Und in seinem Spiegel scheint Griechenland einig und einheitlich im Götterglauben, ... In Wirklichkeit kann - das darf man kühn behaupten - diese Einheit nicht vorhandenen gewesen sein; die Grundzüge des panhellenischen Wesens waren zweifellos vorhanden, aber gesammelt und verschmolzen zu einem nur vorgestellten Ganzen hat sie einzig der Genius des Dichters "
Dieses homerische Weltbild, in dem die Götter und Göttinnen des 0lymps die zentrale Bedeutung haben, ist nun mit der überkommenen archaisch-volksreligiösen Tradition, der Tradition der Lokalkulte, in ein eigentümlich Allianzverhältnis getreten. Man könnte hier auch - in ungezwungener Analogie zu Nicolai Hartmanns Schichttheorie - von einem Überformungsverhältnis sprechen. Überformung meint hierbei, dass beim Übergang von der älteren Schicht in die jüngere nichts Wesentliches verloren geht Dies deshalb, weil (immer noch in Anlehnung an Hartmanns Theorie) in beiden Schichten die gleiche kategoriale Struktur - in unserem Fall die mythische - herrscht. Homerisches Weltbild und archaischer Volkglaube sind in der Antike gleichermaßen mythisch strukturiert: deshalb können sie auch jederzeit miteinander in Beziehungen treten. Ein Beispiel, wo das besonders augenscheinlich wird, sind die diversen, den homerisch-olympischen Gottheiten geweihten antiken Tempelbauten.
Der Kürze halber sei hier nur auf das Hera-Heiligtum auf Samos verwiesen, wo sich dieses Überformungsverhältnis deutlich zeigt. An nach folgendem Grundriss des Heiligtums aus dem frühen ersten Jahrtausend lässt sich das gut nachvollziehen. Neben den an einen Ort (Kultbaum) gebundenen Daimon (evtl. Bauinnymphe) tritt die landschaftlich übergreifende Göttin (Hera) und ihr Tempel, bzw. Kultbau. Der unmittelbare Altarbereich mit dem Kultbaum und ein primitiver Vorläuferbau lassen sich archäologisch bis ins dritte Jahrtausend zu den karischen Ureinwohnern zurückverfolgen. Hera nicht. Sie kann frühestens mit den griechischen Eroberern im zweiten Jahrtausend hierher gekommen sein. Baum und Tempel haben, wie der Grundriss aus der Zeit der Spätantike zeigt, trotz mannigfacher Überformungen, eine vergleichsweise kontinuierliche, dreitausendjährige Tradition.
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Die mythisch-homerische Erfahrung des Genius Loci
Es wurde immer wieder bemerkt, dass viele der antiken Tempel in einem deutlichen Bezug zur Umgebung stehen; dass sie sich einerseits der Landschaft anpassten, andererseits sie in ihrer charakteristischen Eigenart betonten, ja gewissermaßen auf den Punkt brachten. Ein Tempel der so genannten kuhäugigen Hera steht z.B. oft in Bezug zu feuchten, viehreichen Niederungen, die Tempel des so genannten fern hintreibenden Apollon bevorzugen Hanglagen mit Fernblick, Poseidon -Tempel finden sich oft quasi über dem Meer schwebend am Kap, Hades-Tempel stehen in deutlichem Bezug zu Eingängen in die Unterwelt, also Schluchten und Klüften, etc.
Die Altphilologin Paula Philippson ist in ihrer Schrift "Griechische Gottheiten in ihren Landschaften" dieser Bezüge nachgegangen und konnte sie nur bestätigen und vertiefen. Die den Tempel umgebende Landschaft wurde von ihr als Kultlandschaft des jeweiligen Gottes beschrieben. Ist der Tempel der Kulminationspunkt dieser Landschaft, so die Landschaft wesentlich auch Erscheinungsform des jeweiligen Gottes. Zwei klassische Beispiele hierzu: das Heraion von Samos, das in einer charakteristisch "heraischen" und der Apollon-Tempel zu Delphi, der in einer charakteristischen "apollinischen" Landschaft eingebettet ist. Aus all diesen Beispielen wird klar ersichtlich, dass der homerische Grieche ein klares Bewußtsein der landschaftlichen Gegebenheiten hatte; dass er zudem die Atmosphäre einer Landschaft nicht nur zu erfahren und erfassen wusste, sondern sich mit seinen Tempelbauten auch architektonisch auf sie einließ und sie dadurch verdeutlichte, hervorhob, steigerte. Ich spreche deshalb hier von einem stimmungsmäßigen Erleben einer Landschaft (unter Berücksichtigung der stimmungsmäßigen und daimonischen Erlebnisse darin vorkommender Orte.) Dass dieses Erleben Ähnlichkeit mit dem ästhetischen Naturerleben der Neuzeit hat, ist offensichtlich; dass es aber nicht mit jenem profanem, oft rein ästhetizistischen Genußerleben der Neuzeit identisch ist, dürfte aus dem ganzen mythischen Kontext, in dem das mythisch-homerische Naturerleben steht, mehr als deutlich erhellen.
|
|
|
|
|
|
|
3. Die christlich-mittelalterliche Spaltung des Genius Loci in Ortsdämon und Ortsheiligen
Mit dem Ende der Antike, sprich: mit dem Beginn des Christentums, wandelt sich die Bewertung des mythischen Genius-Loci-Begriffes. Es ist v.a. der christlich-monotheistische Schöpfungsgedanke, der die Genii Locorum als abgeleitete, abgefallene Phänomene erscheinen läßt. Damit einher geht die Dämonisierung der Ortsgeister. Es ist die christliche Eschatologie, die ferner die Genii Locorum als erlösungs- und d.h. auch auflösungsbedürftig erscheinen läßt. Trotz all dieser Tendenzen wird die daimonische Wirklichkeit der Ortsgeister nicht angezweifelt, allein ihre Bewertung wandelt sich.
Das zwiespältige Verhältnis des mittelalterlichen Christentums zum Genius Loci kommt nicht nur in der Geschichte der Wallfahrtsstätten - der heiligen Orte des Christentums - sondern auch im Volks-(aber-)glauben deutlich zum Ausdruck. Bei den ersteren handelt es sich meist um einen ins Christliche transformierten, von daher mehr oder weniger akzeptierten, bei letzterem um einen dämonisierten, aus christlicher Sicht inakzeptablen Genius-Loci-Kult. Ein Beispiel für ersteres wäre die Wallfahrtskirche der heiligen Edigna bei Puch (Fürstenfeldbruck) mit der "tausendjährigen" Linde und ihrem dazugehörigen Kult und der dazugehörigen ätiologischen Legende. Ein Beispiel für zweites wäre der Teufelsberg in der Aubinger Lohe im Münchener Westen: ein Ort, an dem, durch zwei keltischen Vierecks-Kulttempel, ein vorchristlicher, polytheistischer Lokalkult bezeugt ist. Dieser Ort wurde nun nicht zum Wallfahrtsort "umgetauft", sondern verteufelt.
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Das christliche Überbauungsverhältnis
Werfen wir einen Blick auf das Heraion von Samos zum Ende der Antike. Das mythische Zeitalter neigt sich seinem Ende, das christliche dominiert. Der christliche Logos bekämpft den Mythos. Christliche Eiferer wie Firmicus im 4. Jh. folgen der Maxime.- "Haut sie zusammen, mit dem Beil zusammen, diese Tempelzierden! Zur Schmelze, zur Münze mit diesen Göttern! Alle Weihegeschenke sind euer, nehmt und braucht sie. " Das Hera-Heiligtum mit dreitausenjähriger Tradition wird von solchen Eiferern zerstört. Der uralte Kultbaum gefällt von christlicher Hand. Auf dem Altar brennt schon längst kein Opferfeuer mehr, kein Stein ruht auf dem anderen. Aus den Trümmern wird, direkt neben dem ehemaligen Kultort, im 5. Jh. eine frühchristliche Basilika gebaut. Sie ist, wie die meisten Kirchen, nach Osten gerichtet, wo die Sonne, das Sinnbild des Christus-Logos, aufgeht. Der konkrete Bezug zum Ort ist gelockert, der Kultbaum erfährt schon längst keine Verehrung mehr, der Genius Loci ist wenig relevant. Mit gestrichelter Linie ist in nachfolgender Zeichnung die Stelle markiert, an der früher der Altarbezirk mit Kultbaum war.
Hier kann man nicht mehr von einem Überformungsverhältnis sprechen. Eher müßte man (wieder in loser Analogie zu Nicolai Hartmanns Schichttheorie) von einem Überbauungsverhältnis sprechen. Denn es zeigt sich klar - und darin liegt der Unterschied zum Überformungsverhältnis - dass beim Übergang von der mythischen Schicht in die christliche Wesentliches verloren geht. Es handelt sich nicht mehr um die gleiche kategoriale Struktur: der christliche Logos ist kategorial anders strukturiert als der antike Mythos: er ist noetisch, d.h. geistig strukturiert. Die Grundkategorien des christlichen Geistes - um nur einige zu nennen - aber sind: Einheit, Weltüberwindung, radikale Transzendenz, Sinnes- und Leibesfeindschaft (damit einhergehend Bilder- und Ortsfeindschaft), radikaler Monotheismus. Sie stehen den mythischen Kategorien - Vielheit, Welthaltigkeit, radikale Immanenz, Sinnes-und Leibesfreude, undogmatischer Polytheismus - diametral gegenüber. Von Überbauungsverhältnis zu sprechen, bietet sich auch deshalb an, weil das christliche Weltverhältnis stark durch einen theologisch-geistigen Überbau dominiert und bestimmt ist. Und ganz konkret legt die Tatsache, dass viele Kirchen über heidnischen Kultstätten gebaut wurden - jene überdeckend, transformierend, überbauend - die Rede von einem Überbauungsverhältnis nahe.
|
|
|
|
|
|
|
Jedoch: Kein Überbauungsverhältnis bricht in allen Aspekten total mit den älteren Schichten. Darauf weist auch Hartmann hin. Seine Worte können hier direkt in unseren Zusammenhang übertragen werden: "So durchbricht eine ganze Reihe von Kategorien das Überbauungsverhältnis und macht es zu einem Überformungsverhältnis im kleinen - aber auch nur im kleinen, denn das Überformungsverhältnis verlangt, daß alle Kategorien durchdringen. Und das ist hier eben nicht der Fall. "
In unserem Beispiel bedeutet das, dass die Basilika ja immerhin noch am gleichen Ort errichtet wurde, also die Kontinuität des Ortes bewahrte; ja sogar aus den gleichen Steinen, wie die Vorgänger-Tempel ist sie erbaut. Und womöglich - und das ist bei vielen Kirchen der Fall übernimmt ein Heiliger/eine Heilige die Rolle der früheren Lokalgottheit; womöglich wird die Kirche zu einer berühmten Wallfahrtskirche und die Wallfahrtsprozession übernimmt die Rolle der früheren Kultumzüge.
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Das christlich-mittelalterliche Erleben des Genius Loci
Dieses Erleben war in letzter Konsequenz vertikal, hierarchisch-transzendierend, nach oben, zum einen Herrn und Schöpfer, christlich-platonisch gesagt in Richtung überhimmlischen Ort, gerichtet, und damit dem Mythos entgegengesetzt.
Doch eben nur: in letzter Konsequenz. Dieser letzten Konsequenz wurde jedoch nicht von allen vollzogen. Oftmals sogar nur von der kirchlich-intellektuelle Obrigkeit. Für alle anderen war das vergleichsweise mythische - mittelalterlich-volksreligiöse Ortserleben, wie es sich in Sagen und Beschwörungen von Lokaldämonen, in Legenden und Kulten von Ortsheiligen spiegelt, verbindlich.
Ein krasses Beispiel, das nicht zuletzt wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Trophonios-Orakel sehr erhellend ist, stammt aus dem Augustinerkloster Lough Derg und der dortigen Höhle des Hl. Patrick in der irischen Grafschaft Donegal. In einem See gelegen befindet sich dort eine zweigeteilte Insel. Der eine Teil eher fruchtbar und anmutig, der andere eher wild und öde. Im ersten Teil liegt das Augustinerkloster, im zweiten die Höhle, die auch "Fegefeuer des Hl. Patrick" genannt wird. Nach einer irischen Legende wurde der Hl. Patrick einst von Gott in diese einsame Gegend geführt und ihm diese Höhle gezeigt, mit dem Hinweis: "wer sie wohl vorbereitet durch [tagelanges Fasten, Beten und] die Sacramente betrete, und eine Tagnacht in ihr verweile, bestehe in ihr seine Reinigung; und seine Sünden würden ihm vergeben, während der Unbußfertige in ihr verderbe. Die Sage setzt hinzu: Einige, die sie besucht, seien nicht wiedergekehrt; die aber zurückgekommen, seien fortan im Glauben treu geblieben; hätten aber nimmermehr gelacht; weil das, was sie dort geschaut, ihnen alle Weltlust bitter gemacht. "
Ein gewisser Oenus wird "um das J 1152 [nach den rituellen Vorbereitungen] in der üblichen Weise in die Höhle gebracht, dort eingeschlossen, und muß nun nacheinander zehn Orte der Pein durchwandern. Was die Einbildungskraft irgend an Plagen und Martern ersinnen kann, ist hier ausgelegt; von Feuerdrachen sind Einige umwunden, andere über Schwefelflammen aufgehängt, noch andere in Bäder geschmolzenen Metalls versenkt; während wieder Welche bleich und als ob sie den Tod oder noch Ärgeres erwarteten, sich an die Gipfel eines Felsens anklammern, bis ein Sturmwind die Unseligen ergreifend, sie in einen unten vorbeifließenden eiskalten und stinkenden Strom hinabschleudert, indem auch der wandernde Ritter beinahe verdorben wäre, hätte ihn das Anrufen des Erlösers nicht gerettet. "
|
|
|
|
|
|
|
4. Neuzeitliche Rationalisierungen des Genius Loci
Mit dem Beginn der subjektzentrierten und rationalistischen Neuzeit geht die Rationalisierung, sprich: Entzauberung der Welt einher. Auch der Genius Loci wird entzaubert und zwar durch verschiedene rationale Reduktionen.
4.1. Rationalistische Reduktionen
Bei den aufklärerischen Denkern des 17. und 18. Jhdts. überwiegt die Tendenz, den Genius Loci, wie auch andere mythische Gestalten, in ihrem Charakter als eigenständige, originäre Phänomene zu negieren, sie als abgeleitete Phänomene, als Selbsttäuschung und/oder Betrug durch andere zu entlarven. Die aufklärerische Entlarvung bedient sich dabei teils explizit teils implizit dreier Argumentationsstrategien. Die erste versucht, den Mythos auf seiner vermeintlich historischen Kern zu reduzieren; die zweite versucht, den Mythos auf seine soziale Funktion zu reduzieren; die dritte, über weite Strecken und bis heute die einflußreichste, erklärt den Genius Loci als Projektion der frühmenschlichen Psyche in die unbelebte Natur. Die Frühmenschen hätten demnach, da ihnen ja die allein seligmachenden, aufgeklärten, naturwissenschaftlichen Erklärungen noch nicht zur Verfügung standen, alle angst- und staunenerregenden, machtvollen Phänome in der Natur allein durch in sie hineinprojizierte Geister- und Götterphantasmen erklären können (z.B. David Hume).
Alle drei Argumentationsstrategien finden sich, ineinander verwoben und unter dem Vorzeichen der "Priester-Betrugs-These", in der für die Genius-Loci-Problematik zentralen Schrift "Geschichte der Orakel" des seinerzeit einflußreichen Aufklärers Bernard le Bovier de Fontenelle wieder.
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Das neuzeitlich-rationalistische Erleben des Genius Loci
Für einen aufklärerischen Mensch wie Descartes ist die Welt gespalten in Denkdinge (res cogitans) und Stoffdinge (res extensa). Alles was nicht denkt, was also kein denkender Mensch ist (Gott als oberste Denkzentrale freilich ausgenommen) ist unbeseelter Stoff. Auch Pflanzen und Tiere (und auch der Mensch, allerdings nur, sofern er auch ein leibliches und kein denkendes Wesen ist) sind Maschinen aus Erde. Die Welt ist eine machina mundi (Weltmaschine). Der oberste Mechanikus, nämlich Gott, hat zum Beginn der Welt diesen ganzen Mechanismus gebastelt und aufgezogen, um ihn dann zu starten. Wie eine aufgezogene Uhr, deren Räder abschnurren, so stellt man sich dann weiteren Weltlauf vor.
Wenn so ein Denkding-Mensch in die Welt schaut, in die Natur und Landschaft blickt, erblickt er folglich nur leblose Materie. Da sie leblos und damit gewissermaßen sinnlos und geistlos ist, ist es unnötig, nach einem Geist eines Ortes zu fragen. Erleben läßt er sich da draußen nicht, außer ein Mensch hat seinen Geist, d. h. die rationale Ordnung seines Geistes der Natur aufgezwungen. D. h. Orte bekommen nur Geist, Seele, Charakter durch den Menschen, Kann man hier von einem Erleben eines vorgefundenen, natürlichen Ortes sprechen? Ich glaube nicht. Deshalb ist die aufklärerische Neuzeit - zumindest wo sie ihrem konsequenten Rationalismus treu bleibt - hinsichtlich der ursprünglichen, d. h. mythischen Genius-Loci-Problematik wenig ergiebig.
Kurz:Die Aufklärung ist eine Zeit, die für Kultorte. und Wallfahrtsstätten wenig Sinn hatte, wie der deutsche Aufklärer Friedrich Nicolai deutlich zeigt: " Wallfahrtsort Mariahilf a. d. Donau: Man sieht sogar nicht selten Wallfahrer, die zufolge eines getanen Gelübdes den hohen Berg auf den Knien heraufrutschen... Es ist doch leicht zu erachten, daß bei einer solchen langen Reise auf den Knien die Haut zerfleischt werden muß. Und wozu soll dies nützen?
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Das neuzeitliche Verplanungsverhältnis
Ein Beispiel, an dem man die aufklärerische Art des Umgangs mit der Natur sehr deutlich sehen kann, an dem man auch erkennen kann, dass diese Zeit nicht wirklich an einem Naturerleben interessiert war, ist der französische Garten. Und zwar genau dort, wo er am reinsten verwirklicht wurde, in Versailles. Der Grundriss des Schlossparks zeigt deutlich, dass man nicht an dem vorgefundenen Ort und seiner numinosen Ausstrahlung interessiert war. Vielmehr galt es die Souveränität und Willensmacht des (höchsten) Menschen (des Sonnenkönigs Ludwig XIV) zu demonstrieren. Der menschliche Geist zwingt seine rationalgeometrischen Entwürfe dem Ort auf. Wie sich das konkret auswirkt, zeigt folgendes Zitat: "Um diese Kunstlandschaft, zu schaffen mußte die alte, vorhandene beseitigt werden. Die [teilweise ur-) alten Bäume, Reste der bäuerlichen Weidelandschaft, mußten fallen. Sie wurden an Ort und Stelle zerteilt. Geländeunterschiede mußten mit Schaufel und Spaten planiert werden. EinSystem von Gräben und Kanälen war notwendig, um das Bewässern der riesigen Gartenanlagen zu sichern. Vierzig Jahre lang war in Versailles ein Heer von Gärtnern und Arbeitern dabei, ... diese Anlagen zu gestalten, zu pflegen und immer wieder umzubauen. ... Ein Kritiker Ludwig XIV., Saint-Simon, ... nennt es, das arrogante Vergnügen, der Natur seinen Willen aufzuzwingen'. ... Dem Menschen, dem König, war nicht nur das freie Wachsen der Pflanzen, das ungehinderte Fließen der Gewässer und die Natürlichkeit der Geländeformen unterworfen, auch die Tiere hatten sich seinem Willen zu beugen. Das demonstrierte der Sonnenkönig mit seiner, Ménagerle Royale de Versailles'. In Käfiganlagen, gestaltet nach ästhetisch-architektonischen Gesichtspunkten, nicht nach den Bedürfnissen der Tiere, wurden hier die 'Bestien' zur Schau gestellt. "
Wir sehen, es handelt sich hierbei um ein - im Vergleich zum christlichen Verhältnis zum Genius Loci - nochmals radikalisiertes Überbauungsverhältnis. Um es von dem christlichen Überbauungsverhältnis, von dem es sich ja qualitativ unterscheidet, abzuheben, nenne ich es das Verplanungsverhältnis. Dies aus zwei Gründen : zum einen reduziert es den vorgefundenen Ort, die vorgefundene, gewachsene Landschaft zu einer rein abstrakten Planfläche, einem Planquadrat, an dem die jeweiligen geistig-logischen, architektonischgeometrischen Koordinaten angelegt werden können; zum anderen muss es - um die Planfläche in die Realität umsetzen zu können - die vorgefundene Wirklichkeit regelrecht plan machen, d.h. planieren, einebnen, nivellieren; d.h, die Eigenart zunächst zerstören.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Die Romantisierung des Genius Loci
Es ist das Zeitalter der Romantik, in dem das antike und mittelalterliche Konzept des Genius Loci wieder Eingang in Kunst und Wissenschaft findet; dies freilich unter romantischen Vorzeichen, unter Vorzeichen also, die zwischen den Polen Verklärung und Entbergung schwanken. V.a. in der romantischen Psychologie des C. G. Carus und G. H. v. Schubert hat sich ein seelisches Verständnis des antiken Phänomens des Genius Loci ausgeprägt , das zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist und erst über ein halbes Jahrhundert später durch L. Klages und C. G Jung wieder Eingang in die wissenschaftliche Diskussion fand.
An der Entwicklung des sogenannten englischen (Landschafts-) Gartens - der im Zuge der Empfindsamkeit als natürlicher Alternativentwurf zum geometrischen französischen Garten im 18. Jh. entstanden ist und dann im Zeitalter der Romantik zur vollen Blüte kam - lassen sich die praktischen Konsequenzen zeigen, die die romantische Rückbesinnung in Bezug auf den Genius Loci mit sich brachte. Zunächst ein Blick auf den Grundriss des englischen Gartens in München. Er zeigt, wie die Planung hier auf die Landschaft Rücksicht nimmt, wie man mit organischen Formen und Strukturen arbeitet. Einordnungsverhältnisse und Über- formungsverhältnisse werden wieder möglich. Noch deutlicher zeigt sich das an einem der berühmtesten mitteleuropäischen Landschaftsgärten, dem englischen Garten des Hermann Fürst von Pückler-Muskau in Muskau / Oberlausitz (Entstehungsphase 1815-45). Die vorgefundene Landschaft wird zwar überformt, aber nicht deformiert. Sie wird eher in ihrem Charakter hervorgehoben. Dass man sich dabei durchaus auch überlieferter Techniken traditioneller Landschaftsmalerei bedient, steht hierzu nicht im Widerspruch, ganz im Gegenteil. Selbst wenn eine heroische, klassische oder melancholische Ansicht inszeniert wird, so doch nicht an der vorgefundenen Landschaft vorbei. Alte heilige Bäume dürfen stehen bleiben, bzw. werden landschaftsgestalterisch in ihrem Eindruck verstärkt, inszeniert.
|
|
|
|
|
|
|
6. Phänomenologische Entbergungen des Genius Loci
Nach dem (unter aufklärerischen Vorzeichen stehenden) Zeitalter des Positivismus, das die romantischen Tendenzen der Entbergung des ursprünglichen Genius-Loci-Konzeptes mit den Schlagworten Naturwissenschaft, Technik, Fortschritt, Evolution in die Vergessenheit abdrängte, setzte Anfang des 20. Jahrhunderts eine Neubesinnung auf die unreduzierten Phänomene des Lebens und der menschlichen Existenz ein. Im Zuge dieser Neubesinnung kam es zur phänomenologischen Wiederkehr des Genius Loci. Folgende theoretische Ansätze sind hier von Bedeutung:
1. Das lebensphilosophisch-phänomenologische Konzept der "Erscheinungswesen" eines Ortes von L. Klages
2. Das tiefenpsychologisch-phänomenologische Konzept der ortsgebundenen "archetypischen Erscheinungen" von C. G. Jung
3. Das existenzphänomenologische Konzept des "Wesens eine Ortes" von M. Heidegger
4. Das leibphänomenologische Konzept ortsgebundener, "räumlich ergossener Atmosphären " von H. Schmitz
Lediglich ein beispielhaftes Zitat, nämlich von Ludwig Klages, soll zeigen, wie sehr man sich im Umkreis der phänomenologischen Bewegung wieder auf das unverdeckte Phänomen des Genius Loci einließ: "Die Alten," so Klages, "kannten den genius loci, den Nimbus, die Aura, und auch wir noch sprechen von der Atmosphäre eines Menschen, eines Hauses, einer Gegend. Nun, diese Atmosphäre, von so genannt sensitiven Naturen erlauscht, von feinfühligen gespürt, robusteren Gemütern unbekannt, ist eine wirkende Wirklichkeit, gebend und bereichernd oder saugend und schwächend, umfangend und erwärmend oder aushöhlend und erkältend, beschleunigend und erregend oder hemmend und dampfend, ausweitend oder einengend beflügelnd oder lähmend, ... "
|
|
|
|
|
|
|
Weil Heideggers existenzphänomenologisches Konzept des Wesens eines Ortes der in Architekturtheorie und Humangeographie am meisten rezipierte Ansatz ist, möchte ich hier näher darauf eingehen. Dieser Ansatz ist nicht zuletzt deshalb so wichtig, weil er, freilich auf ganz eigentümliche Art und Weise, die bisher skizzierte Kulturgeschichte des Genius Loci nochmals bedenkt. Das Schwergewicht dieses Ansatzes liegt - und den, der die Heideggersche Vorliebe für die frühe klassische Antike kennt, wundert das nicht - im Bereich des mythisch-homerischen Überformungsverhältnisses. Als Beispiel diene die Heideggersche Interpretation des griechischen Tempels: "Ein Bauwerk, ein griechischer Tempel, bildet nichts ab. Er steht einfach da inmitten des zerklüfteten Felstales. Das Bauwerk umschließt die Gestalt des Gottes und läßt sie in dieser Verbergung durch die offene Säulenhalle hinausstehen in den heiligen Bezirk ... Dastehen ruht das Bauwerk auf dem Felsgrund. Dies Aufruhen des Werkes holt aus dem Fels das Dunkle seines ungefügen und doch zu nichts gedrängten Tragens heraus. ... Das Unerschütterliche des Werkes steht ab gegen das Wogen der Meerflut und läßt aus seiner Ruhe deren Toben erscheinen. Der Baum und das Gras, der Adler und der Stier, die Schlange und die Grille gehen erst in ihre abgehobene Gestalt ein und kommen so als das zum Vorschein, was sie sind. "
In seinem Aufsatz "Bauen Wohnen Denken" von 1951 hat Heidegger am Beispiel einer Brücke veranschaulicht, was seiner Ansicht nach das Wesen eines Bauwerkes ist. Die Brücke ist nach Heidegger ein Ding. Ding hier in einem speziellen Sinne als das, was das Wesen auf den Punkt bringt, konzentriert oder, wie Heidegger sagt "versammelt". "Die Brücke ist freilich ein Ding eigener Art; denn sie versammelt das Geviert [von Erde, Himmel, Göttlichem und Menschlichem] in der Weise, daß sie ihm eine Stätte verstattet. Aber nur solches, was selber ein Ort ist, kann eine Stätte einräumen. Der Ort ist nicht schon vor der Brücke vorhanden. Zwar gibt es, bevor die Brücke sieht, den Strom entlang viele Stellen, die durch etwas besetzt werden können. Eine unter ihnen ergibt sich als ein Ort und zwar durch die Brücke. So kommt denn die Brücke nicht erst an einem Ort zu stehen, sondern von der Brücke selbst her entsteht erst ein Ort. Sie ist ein Ding, versammelt das Geviert, versammelt jedoch in der Weise, daß sie dem Geviert eine Stätte verstattet. Aus dieser Stätte bestimmen sich Plätze und Wege, durch die der Raum eingeräumt wird. ... Demnach empfangen die Räume ihr Wesen aus Orten und nicht aus 'dem' Raum "
|
|
|
|
|
|
|
D.h. das Bauwerk ist ein versammelndes Ding. Es konstituiert den Ort und hebt ihn dadurch von der bloßen Stelle ab. Auf diesen Abschnitt haben sich nun konstruktivistische Architekturtheoretiker berufen, um einer reinen Entwurfsarchitektur das Wort zu reden. Erst durch den architektonischen Entwurf würden Orte und damit auch Landschaften als charakteristische konstituiert oder besser: konstruiert. So z. B. Dörte Kuhlmann, die zur Ansicht tendiert, der Genius Loci, das Wesen eines Ortes, sei "nicht primär vorhanden, sondern wird erst durch die Architektur aufgedeckt und konstituiert. Der Ort wird mittels des künstlichen Eingriffes von seiner Umgebung individuiert und erhält dadurch seinen spezifischen Charakter, ... " Ja, wie Kuhlmann meint, scheint dem Genius Loci deshalb nur " ein sekundäres Moment oder vielleicht sogar ein parasitärer Charakter " zuzukommen.
Wenn diese Interpretation von Kuhlmann den entscheidenden Punkt träfe, würde es bei Heidegger nicht um ein Überformungsverhältnis, sondern um ein Uberbauungsverhältnis handeln. Denn erst im Überbauungsverhältnis tritt mit der menschlichen Gestaltung etwas völlig Neues, ein neues Prinzip an diesem Ort, bzw. an dieser Stelle ein. Entwurfsarchitektur setzt frühestens auf der Ebene des Überbauungsverhältnisses ein, oft auf der des Verplanungsverhältnisses.
Eine tiefer dringende Heidegger-Lektüre ergibt jedoch ein anderes Bild; sie zeigt, dass wenngleich auch der existenzielle Ort, denn um den handelt es sich bei Heidegger schließlich, erst mit dem architektonischen Ding entsteht - der natürliche, naturgegebene Ort - oben von Heidegger Stelle genannt - vorgängig schon immer da ist. Dies natürlich nicht im gegenständlichen Sinne, sondern im phänomenologischen. Ein Blick in den Dialog "Zur Erörterung der Gelassenheit": hier versucht Heidegger das Wesen der Gegend, man könnte auch sagen, der Landschaft, zu bestimmen. Er hat für diese Art der landschaftlichen Gegend den Namen Gegnet geprägt, um damit auszudrücken, dass es hier um etwas Wesentliches geht, das einem begegnet, wenn man sich darauf einlässt. Dort heißt es nun:
|
|
|
|
|
|
|
"L: Wie sollen wir also den Bezug der Gegnet zum Ding benennen, wenn die Gegnet das Ding in ihm selbst als das Ding weilen läßt?
F: Sie bedingt das Ding zum Ding.
G: Sie heißt daher am ehesten Bedingnis.
F: Aber das Bedingen ist kein Machen und Bewirken; auch kein Ermöglichen im Sinne des Transzendentalen...
L: sondern nur die Bedingnis.
F: Was das Bedingen ist, müssen wir also erst denken lernen... L: indem wir das Wesen des Denkens erfahren lernen...
G: mithin auf Bedingnis und Vergegnis warten. "
D.h.: das architektonische Ding, in unserem Beispiel die Brücke, wird erst zu einem, den Ort versammelnden Ding, indem es durch den vorgängigen natürlichen Ort, die Gegnet, dazu bedingt wird. Damit ergibt sich: Die primäre Basis des Genius Loci ist die besinnliche Begegnung mit der Gegend im Sinne eines Einordnungsverhältnisses. Erst dadurch wird das nächste Verhältnis möglich, das gerade deshalb, weil es auf dem Einordnungsverhältnis ruht und von ihm wesentlich bedingt wird, ein Überformungverhältnis ist.
|
|
|
|
|
|
|
Der Architekturtheoretiker Christian Norberg-Schulz hat in seinem, auf den Arbeiten Heideggers aufbauenden Buch "Genius Loci - Landschaft, Lebensraum, Baukunst" eine Heidegger-Interpretation gegeben, die in die ähnliche Richtung zielt: "Der existentielle Zweck des Bauens (Architektur) ist es deshalb, aus einer Stelle einen Ort zu machen, das heißt, den potentiell in einer gegebenen Umwelt vorhandenen Sinn aufzudecken. "
Dies geht aber nicht ohne dass man sich auf das Spezifische, das man "vor Ort" immer schon vorfindet, einlässt, ihm begegnet. Dieses Spezifische nennt Norberg-Schulz den "Charakter": "Ein letzter und besonders wichtiger Schritt wird mit dem Begriff ,Charakter' vollzogen. Charakter ist durch das Wie der Dinge bestimmt und verankert unsere Untersuchung in den konkreten Phänomenen unserer alltäglichen Lebenswelt. Nur so läßt sich der genius loci ganz erfassen - jener , Geist, der an einem Ort herrscht' und der in der Antike als ,Gegenüber' verstanden wurde, mit dem der Mensch sich einigen muß, will er das Wohnen vermögen."
|
|
|
|
|
|
|
7. Der alte Südfriedhof in München und Ania Thea Bayer - Ortsbekundung "Rote Asche gibt es nicht"
Ich habe mich bisher v.a. auf idealtypische Konzepte und mehr oder weniger idealtypische Beispiele beschränkt, um eine kleine Kulturgeschichte des Genius Loci zu geben. Wenn ich jetzt auf den am alten südlichen Friedhof in München und das künstlerische Projekt "rote Asche gibt es nicht" von Anja Thea Bayer zu sprechen komme, begehe ich keine Themaverfehlung. Ganz im Gegenteil: mit diesem Projekt befinden wir uns mitten in der Genius-Loci-Thematik. Denn hier geht es in ausgezeichneter Weise um den Ort und seinen Geist; hier begegnet uns die Kulturgeschichte des Genius Loci konkret. Dieser Ort hat Geist, hat Charakter, hat Atmosphäre, hat Tiefgang - und zwar in einem ganz einzigartigen, von ihm nicht ablösbaren Sinn. Dieser Ort hat zudem auch etwas Unnahbares, hat etwas, das nicht in Begriffsschubladen unterteilt werden kann. Dieser Ort hat auch etwas Befriedendes, Versöhnendes und zwar so, wie auch der Tod befriedet, versöhnt: nämlich mit einem wehmütig-bitteren Unterton. Dieser Ort hat eine faszinierende, tiefgehende Ausstrahlung. Das ist m. E. deutlich spürbar, erlebbar. Doch die Frage ist: Wieso hat er das? Meine Antwort - welche zunächst nicht mehr als eine vorläufige Hypothese zu sein beansprucht - lautet: Dieser Ort hat eine enorme Ausstrahlung und Bedeutungstiefe, weil sich an ihm eine Vielzahl geschichtlicher und natürlicher Bedeutungen eingraben, einzeichnen konnten, weil hier, auf engstem Ort, nicht nur Raum für ein Verplanungs- und Überbauungsverhältnis, sondern auch für ein Überformungs- und Einordnungsverhältnis ist. Der Friedhof bringt beim Besucher viele Bedeutungssaiten zum klingen. Der alte Südfriedhof hat etwas durch und durch Gewachsenes an sich. Er ist hierin einem alten Baum vergleichbar: mit seiner Krone überschattet er unser heutiges Dasein und zugleich reicht er mit seinen Wurzeln bis in den Mythos hinab.
Dies sei kurz erläutert: Die Menschen, die in diesem Friedhof wandeln, sind die Großstadtmenschen unserer Zeit: Ruhesuchende, Verliebte, Betrunkene, eilig Schreitende, Nachdenkliche, Einsame, usw.. Die Geräusche die über die Friedhofsmauer hereindringen, sind die Geräusche unserer Zeit: Motorengebrumm, Musikfetzen, Menschenstimmen, Tramgebimmel, Geräusche von Straßenarbeitern, usw.: ein Friedhof mitten in unsere Zeit, ein Friedhof, der mit seinen Baumkrone unser heutiges Dasein überschattet.
Mehr: die Anordnung der Wege und überhaupt der geometrische Grundriss des Friedhofs erinnert an die französischen Gärten mit ihrer klaren, geometrischen Struktur.
|
|
|
|
|
|
|
Doch das ist nur ein leiser Anklang und das Gefühl, das sich in Bezug auf echte Verplanungsverhältnisse einstellt, mag hier nicht in seiner Radikalität und Ausschließlichkeit aufkommen. Zur sehr hat Geschichte und Natur das, was einmal geplanter Entwurf, was einmal rationale Ordnung war überformt.
Betrachten wir weiterhin die Gesamtform des alten Teils des Friedhofs: sie gleicht einem Sarg und ist damit auch Ausdruck eines Überbauungsverhältnisses: nämlich des christlichen, das sich an diesem Ort mit aller Deutlichkeit eingegraben, eingezeichnet hat. Diese Sargform weist über den Ort hinaus an den überhimmlischen Ort des christlichen Jenseits. Dieser christlich-weltflüchtige Eindruck herrscht ja auch sonst im Friedhof vor: wenn man durch die Gräberreihen geht, umweht einem eine andere Zeit, eine andere Stimmung: die christlichen Grabdenkmäler mit ihren Engeln, Kreuzen, Marienfiguren, mit ihren Sprüchen "Hier ruhen in Gott", "Hier ruhen in Frieden", "Wiedersehen unser Trost, Im Kreuz ist unser Heil" oder - wie auf der Grabstätte der Familie Jaumann zu lesen -"Die am Abend freudig sich umfassen, / Sieht die Morgenröte schon erblassen, / Selbst der Freundschaft und der Liebe Glück, / Lässt auf Erden keine Spur zurück." etc. etc. beschwören eine Zeit, in der die christliche Weltsicht noch viel verbindlicher, bindender war wir heute, sie rufen uns ein "memento mori" zu, und beschwören damit eine christlich-abendländische Tradition die über den Barock zurück ins Mittelalter reicht.
Dieser Eindruck wird nicht zuletzt durch die teilweise verwitterten, schrägstehenden, überwachsenen, verkommenen Grabsteine hervorgerufen. Man fühlt sich an die romantischen Gemälde Caspar David Friedrichs, z. B. an das unvollendet geblieben Gemälde "Der Friedhofseingang" von 1825 oder an das Bild "Klosterfriedhof im Schnee" von 1817/19, erinnert; und damit zugleich an das vergangene und aus den Ruinen dennoch hervorleuchtende Mittelalter. Gerade die romantische, sich ins Mittelalter zurücksehnende Bedeutungskomponente ist mit dem Friedhof engstens verknüpft. Liegt das vielleicht auch daran, dass die sterblichen Überreste eines Franz von Baader, Carl Spitzweg, Moritz von Schwind und Joseph von Görres hier liegen, ihre sehnsuchtsvollen Seelen hier immer noch geistern?
|
|
|
|
|
|
|
Ich spreche von geisternden Ahnenseelen: Damit habe ich die Schwelle vom Mittelalter in den Mythos schon betreten: denn der Ahnenkult stellt eine der Hauptwurzeln des Mythos dar. Und der Ahnenkult im mythischen Sinne hat, wenn überhaupt in München, dann hier seinen Ort. Wo sonst lässt sich ein Ort finden, an dem die Genien der Ahnen, die zum heutigen Genius Loci Münchens einen bedeutenden Beitrag leisteten, so präsent sind?
Das Verplanungs- und Überbauungsverhältnis, das auch in diesem Friedhof seine Spuren hinterlassen hat, ist zum Glück nicht zu ausgeprägt: es läßt immer wieder Raum und kleine Nischen, in denen sich Überformungsverhältnisse und Einordnungsverhältnisse zeigen können. Auch das ist ein Zeichen für die mythischen Bedeutungen, die an diesem Ort mitschwingen und mitschwingen können. Bei manchen Grabdenkmälern hat man regelrecht das Gefühl, dass sie am rechten Ort stehen, gleiches gilt für einige Bäume, die nicht nur durch ihr Alter und individuelle Gestalt beeindrucken, sondern auch durch den Ort, an dem sie stehen. Dass der Friedhof nicht nur unter Denkmal- sondern auch unter Naturschutz steht, kommt den Selbstgestaltungskräften der Vegetation natürlich sehr zu gute.
Dass in diesem Friedhof auch Raum für Überformungs- und Einordnungsverhältnisse ist, zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass so etwas wie Anja Thea Bayers künstlerische Ortsbekundung hier möglich ist. Mehr noch: die Ortsbekundung selbst legt Kunde ab, von der Bedeutungstiefe und Einzigartigkeit dieses Ortes: Der Punkt, an dem die Symmetrie und das Verplanungsverhältnis dieses Ortes zerbricht, wird durch den mit "Aachener Rother Erde" ausgelegten Weg markiert. Hier zerbricht - um mit Heidegger zu reden - die Logik des "(be)rechnenden Denkens": ein "besinnliches Nachdenken" setzt ein, ein Denken, das, bevor es später durch den abendländischen Logos und seinen mittelalterlichen und neuzeitlichen Ableger überbaut und verplant wurde, in der mythischen Antike leibte und lebte. Ein besinnliches Nachdenken, das es vermag, an diesem Ort und mit Hilfe dieses Ortes die zahllosen Verplanungs- und Überbauungsschichten, die uns sonst vom Geist des Ortes trennen, zu durchdringen, um so zum Genius Loci zu gelangen. Zu einem Genius Loci, dessen Heiligtum ein alter Friedhof, dessen Kultort ein roter Weg mit Eibe ist und dessen Name lautet: rote Asche gibt es nicht".
nach oben
|
|
|
|
|
|
|
2. Genius Loci - "Genius und Daimon" von Marco Bischof,
Hagia Chora Nr. 6/2000.
Einleitung
Der Begriff des Genius Loci ist seit einiger Zeit vielfach im Gespräch, vor allem seit ihn der norwegische Architekturtheoretiker Christian Norberg-Schulz 1980 in seinem gleichnamigen Buch zur Kennzeichnung seines phänomenologischen Ansatzes in der Untersuchung des Verhältnisses von Architektur und Landschaft verwendet hat. Er spielt nicht nur in der Geomantie eine Rolle, sondern wird in den verschiedensten Disziplinen, neben der Architekturtheorie unter anderem auch in der Humangeographie, Ökopsychologie, Garten- und Landschaftsgestaltung, Religionswissenschaft, Archäologie und Literaturwissenschaft verwendet. Bereits eine flüchtige Recherche zeigt, daß der Begriff auch im Internet in allen möglichen Zusammenhängen auftaucht, vom Prüfungsthema an Architekturabteilungen von Universitäten über die Namen von irgendwelchen Websites, deren Zusammenhang mit ihm nicht deutlich ersichtlich ist, bis zur Musikgruppe, die sich nach ihm nennt.
Robert Kozijanic weist darauf hin, dass dabei auf den ersten Blick der Eindruck entsteht, man hätte es immer mit den gleichen Begriffen, Ansätzen und Phänomenen zu tun, dass dieser Eindruck aber falsch ist. "Es handelt sich um verschiedene Diskurse, die jeweils unter Genius loci etwas anderes verstehen. Die Palette dessen, was Genius loci sein soll, reicht dabei von der rein metaphorischen und rhetorischen Bedeutung des Wortes über die geschichtliche eines an einem Ort erscheinenden "Zeitgeistes" und eines soziokulturell konstruierten "Ortsgeistes", ferner über die Bedeutungen von ökologischen, ästhestischen und synästhetischen Qualitäten von Orten bis hin zu ortsgebundenen "Energiefeldern" und "ortsansässigen" Naturgeistern".
Mir scheint, dass der Grund für diese Vielfalt von "Diskursen", d.h. Denk- und Sprechweisen, über den Genius loci zumindest teilweise darin liegt, dass nur wenige versuchen, die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes in der antiken Kultur zu verstehen und der Begriff deshalb zum unscharfen Behälter für unzählige Projektionen werden konnte. In altertumswissenschaftlichen Nachschlagewerken und Fachbüchern über römische Religion findet sich zwar recht vieles über den lateinischen Begriff des "Genius", jedoch nur Spärliches über den spezifischen "Genius loci". Es bleibt deshalb die Aufgabe, herauszuarbeiten, was am Konzept des "Genius" für den ortsbezogenen Genius, und damit für die Geomantie, von grundsätzlicher Bedeutung ist. Dies versucht der Autor im Folgenden unter Heranziehung der griechischen Entsprechung zum "Genius", dem "Daimon".
|
|
|
|
|
|
|
Der römische Genius
Das lateinische Wort "genius" ist von dem Verb "genere" bzw. "gignere" (zeugen, erzeugen) abgeleitet und bedeutet "derjenige (oder dasjenige), der/das (er)zeugt, der/das Zeugende, oder auch "dasjenige, was zeugungsfähig macht". Jeder Mensch hat seinen/ihren Genius; ursprünglich wurde der Begriff wohl für beide Geschlechter verwendet, später nur noch für den Mann, während als weibliche Entsprechung den Frauen eine "Juno" zugeschrieben wurde. Juno bedeutet "junge Frau" und ist die weibliche Form des Wortes "juvenis". Der Genius eines Menschen tritt zusammen mit diesem ins Leben; sein Fest ist deshalb der Geburtstag. Beim Genius wird geschworen, und neben den Festen des "genius natalis" (des persönlichen Geburtsgenius), die im Hause der Betreffenden mit Wein, Kuchen und Weihrauch auf bekränztem Altar, mit Tanz und gelegentlich auch mit blutigen Tieropfern begangen werden, wurde dem Genius, zusammen mit den Göttern Tellus (Erde) und Silvanus (Waldgott) im Herbst auch eine sakrale Feier mit Blumen- und Weinopfer gewidmet. Dem genius natalis wurde dabei für das neue Jahr gedankt und Wünsche für die Zukunft vorgetragen. Er wird meist als Schlange abgebildet, die sich oft um einen Altar windet und die darauf liegenden Opfergaben verzehrt, wie in dem abgebildeten Wandgemälde aus Herkulaneum. Abbildungen als Jüngling mit Füllhorn, der meist beim Darbringen von Opfern dargestellt wird, oder als jünglingshaftes Flügelwesen, kommen auch vor.
Später, in der christlichen Zeit, verschmolz der Genius mit dem "Schutzengel". Einen Genius haben auch Gruppen von Menschen, wie z.B. Handwerkergilden und Truppenteile, der römische Staat, die Stadt Rom und schließlich Orte, Landschaften und sogar einzelne Gebäude.
|
|
|
|
|
|
|
Über den Genius, der zu den wichtigsten und ältesten Bestandteilen der römischen Religion gehört (W.F.Otto), findet man in der altertums- und religionswissenschaftlichen Fachliteratur teilweise widersprüchliche Beschreibungen und Deutungen. Einig sind sich die Experten darüber, dass er für die Römer einerseits eine Art Gott oder ein göttliches Wesen im Menschen, und deshalb unsterblich, andererseits Begleiter und Schutzgeist (tutela) war. Nicht klar ist u.a. seine Lokalisierung, da er manchmal außerhalb des Körpers, manchmal auch im Körper befindlich gedacht wurde. Der Genius hat sicher mit der Zeugungsfähigkeit zu tun und ist deshalb auch der Schutzgott des Ehebettes (lectus genialis). Was es hingegen bedeuten soll, dass der Genius den Menschen zeuge, ist wieder weniger deutlich; wir lesen, daß durch seinen Hinzutritt das individuelle Leben entstehe, das er auch fortwährend erhalte. Zudem heißt es von ihm, dass er beim Tod des Menschen auch sterbe, doch gleichzeitig hört er dann nicht zu existieren auf: er scheidet nur aus dem Weltleben aus und wird zum Begleiter der Totenseele.
Bevor ich näher auf diese Unklarheiten zu sprechen komme, möchte ich zunächst bei den deutlicheren Eigenschaften des Genius verweilen. Wie Roscher schreibt, ist der Genius nicht nur Zeugungsfähigkeit, Kraft, Energie, Schicksal und Glück eines Mannes, sondern begann schon früh in erweiterter Bedeutung für "alle leitenden, bestimmenden Triebe im Manne, seinen Glückseligkeitstrieb, seine gesamte Persönlichkeit und seinen Charakter" zu stehen. Als göttlicher Schutzgeist ist der Genius dasjenige in uns, was unsere Entschlüsse bestimmt, und deshalb unser Schicksal und Glück. Er bestimmt den individuell verschiedenen Charakter des Menschen und die glückliche oder unglückliche Hand in der Steuerung des Lebensverlaufs, Erfolg und Misserfolg. Er ist aber auch der Genusstrieb und die natürliche Lebenszuversicht und Lebensfreude im Menschen; einen "unbeschädigten Genius" (genius indemnatus) zu haben, heißt unbehelligt sein Leben zu genießen und alles zu tun, was den Genius erfreut. Wer diesem Lebensinstinkt nachgibt, gut isst und trinkt und dabei nicht knausrig ist, "indulget genio" (frönt dem Genius), wer es nicht tut, handelt "genio sinistro" (mit ungünstigem Genius). Geizhälse und Puritaner liegen im Krieg mit ihrem Genius. Das Eigenschaftswort "genialis" bedeutet neben "fruchtbar" auch "gastlich", "üppig", "von liberaler Gesinnung" und "großzügig".
|
|
|
|
|
|
|
Das griechische Daimon
Unter Fachwissenschaftlern ist man sich einig, daß das griechische "Daimon" (d a i m v n) die Entsprechung zum römischen Genius darstellt. Obwohl dies wohl bereits in einem gewissen Masse für das ursprüngliche römische Genius-Konzept zutrifft, sind im Laufe der massiven Beeinflussung der römischen Kultur durch griechische Einflüsse im Laufe der Zeit die meisten Eigenschaften des Daimon auf den Genius übertragen worden (W.F.Otto).Das Wort wird von d a i o m a i (daiomai, teilen, zerreissen) abgeleitet und von manchen Gelehrten als "Zerreisser, Fresser, (der Leichen)" gedeutet; wahrscheinlicher ist aber die Bedeutung "Zuteiler (des Schicksals), d.h. "das die m o i r a (Moira, Schicksal) Aktualisierende" (W.Pötscher). Jeder Mensch erhält bei der Geburt einen Daimon, der wie der Genius zugleich göttlicher Anteil des Menschen, eine Art Seelenteil und Schutzgeist ist, aber auch als Lenker und Bestimmer des Schicksals gilt und der nach dem Tod überlebende Teil des Menschen ist. Daimones sind für die Griechen deshalb auch die Geister der Toten, sowie die "Heroen", die unsterblichen Geister der Ahnen des Goldenen, Silbernen und heroischen Zeitalters, die als eine Art substantielles Zwischenglied zwischen Göttern und Menschen betrachtet werden. Wie der Genius, so ist der Daimon etwas Halbgöttliches, aber unbestimmter als der Gott. Ebenfalls einig sind sich Römer und Griechen darin, dass Genius und Daimon unbestimmte und geheimnisvolle, unkontrollierbare und unberechenbare Möglichkeiten und Potenzen im Menschen wie in der Natur darstellen, wobei bei den Griechen das Gefährliche und Unheilvolle des Daimon im Vordergrund steht, während der römische Genius eher als etwas Wohltätiges und Harmloseres erscheint. Auch das Daimon wird als Schlange abgebildet.
|
|
|
|
|
|
|
Genius und Daimon als überindividuelle Seelen-, Zeugungs- und Machtpotenz
Durch den Vergleich mit dem griechischen Daimon wird vieles deutlicher, was in den erwähnten Erläuterungen zum römischen Genius unklar bleibt. Zu einem sinnvollen Ganzen fügten sich diese Informationen für mich jedoch erst durch einige Bemerkungen des schottischen Altertumswissenschaftlers Herbert Jennings Rose und seines deutschen Kollegen Franz Altheim, besonders aber durch die tiefgündige Arbeit des englischen Sprachwissenschaftlers Richard B. Onians. Rose betont wie schon Walter F.Otto, dass der Genius als das zeugungsfähige Prinzip einerseits nicht im modernen Sinne von Männlichkeit und Sexualität, sondern im Sinne einer allgemeinen "Hervorbringungskraft" oder eines "Werdegeistes" und auch als eine Art "Persönlichkeitskraft"zu verstehen ist. Auf der anderen Seite stellt es auch nicht die individuelle Zeugungs- und Lebenskraft dar, sondern "das fortzeugende, die Familie von einer Generation zur anderen erhaltende Prinzip" (W.F.Otto). Rose betont, daß es "nur einen Genius pro Familie, ursprünglich wohl nur einen für jede 'gens' (röm. Geschlechtsverband, Sippe)" geben könne. Der Genius (und die Juno) sind "Geister, die zu keinem lebendigen oder toten Individuum gehören, sondern zum Clan" (Rose).
|
|
|
|
|
|
|
Genius und Daimon und die antike Persönlichkeitstheorie
Onians bringt in seinem immer noch unübertroffenen Werk über den archaischen "Ursprung des europäischen Denkens über Körper, Geist, Seele, Welt, Zeit und das Schicksal" von 1951 gegen die üblichen Darstellungen des Genius mit Recht den grundlegenden Einwand vor, daß die Persönlichkeit eines Menschen, seine Genussfähigkeit usw. eine Angelegenheit des bewussten Ich seien; beim Genius aber handle es sich nicht um den bewussten Teil des menschlichen Ich. Wir finden in seinem Buch denn auch eine spannende, wenn auch etwas verstreute Darstellung der antiken Anthropologie oder Persönlichkeitstheorie, die bei Römern und Griechen in ihren Grundzügen dieselbe ist. Ihre weitgehend sehr archaischen Züge, die Parallelen in vielen anderen alten Kulturen besitzen, sind für das Verständnis des Genius (und seiner griechischen Entsprechung "Daimon"), aber auch für dasjenige des Genius loci von grundlegender Bedeutung.
Nach römischem Glauben gibt es im lebenden Menschen zwei "Geister" oder Seelenteile, den Genius, der nach Onians der "anima" gleichzusetzen ist, und den "animus". Ihnen entsprechen bei den Griechen die "Psyche" (bzw. der "Daimon") und der "Thymos". Der Animus (bzw.Thymos), der in der Brust lokalisiert wird, stellt das bewusste Ich dar, Genius, Psyche und Anima hingegen das unbewusste Ich, das vitale Prinzip im Menschen, das für den archaischen und antiken Menschen im Kopf wohnte. Der Animus (Thymos) stirbt mit dem Körper, während der Genius (Anima, Psyche) den Tod überlebt.
|
|
|
|
|
|
|
Genius und Daimon als "Kopfgeister"
Dem Römer galt der Vorderkopf als dem Genius heilig; wer seinen Genius ehren wollte, berührte mit der Hand seine Stirn. Die Augenbrauen einer Frau, so hiess es, gehören der Juno. Die besondere Heiligkeit des Kopfes ist ein Kennzeichen der meisten archaischen Kulturen. Wie ich bereits in meinem Buch "Unsere Seele kann fliegen" (1985) dargestellt habe, wurde der Kopf von den Menschen der Steinzeit über Kelten und Germanen bis zu Griechen, Römern, Hebräern und Indern als Sitz von Seele und Lebensgeist, Zeugungskraft, Persönlichkeit und göttlicher "Macht" und deshalb als heilig betrachtet. Wie für Römer und Griechen sass auch für die Germanen das bewusste Ich in der Brust, das den Tod überlebende Seelenteil hingegen wurde im Kopf lokalisiert. Heirat, Verwandtschaft und Kameradschaft wurden als "Angelegenheiten des Kopfes" betrachtet; die Angelsachsen bezeichneten einen Gefährten oder Partner als "Kopf-Gefährten" (heafod-gemaeca), einen Sohn als 'heafod-maga' (Kopf-Sohn). Der Kopf war dem Freyr, dem Gott der Fortpflanzung und Fruchtbarkeit geweiht, dessen heiliges Tier der Eber war, weshalb der Helm des Kriegers einfach nur "Eber" hiess.
Den Römern galt der Kopf (caput) als Wohnstätte des Genius, als Behälter und Quelle des männlichen Samens und als Sitz des Lebens, so wie auch die Quelle eines Flusses oder Baches sein "Kopf" genannt wurde. Das lateinische Wort für Gehirn, "cerebrum", das gleichzeitig "Rückenmark" bedeutet, ist verwandt mit "Ceres", der Göttin der Fruchtbarkeit, die besonders mit dem Korn im "Kopf" der Kornähre in Verbindung gebracht wurde, und deren Name (wie sein männliches Gegenstück "Cerus") "Erzeugerin" bedeutet. Im frühen Latein hatten die Wörter "cerrus" und "cerus" eine ähnliche Bedeutung wie "genius". Der Glaube, dass der Genius im Kopf wohnt, erklärt auch, warum das Haar vom Dichter Apuleius "genialis" genannt wird: es ist aufs engste verbunden mit der zeugenden Lebensseele und Lebenssubstanz, was auch die Erklärung für die Samson-Geschichte in der Bibel ist. .
|
|
|
|
|
|
|
Genius und Lebenssaft
Ein wichtiger Aspekt des Kopfes als Sitz des Lebensgeistes Genius ist der Zusammenhang mit dem "Lebenssaft". Onians hat durch seine Forschungen über die Wurzeln der zentralen griechischen und römischen Begriffe deutlich gemacht, dass die Vorstellung eines Lebensgeistes mit derjenigen eines Lebenssaftes verbunden ist. Lebendig sein heisst "voller Saft sein". Dieser mit dem Genius und der "Psyche" verbundene Lebenssaft, bei den Römern "sucus" oder "umor", bei den Griechen "Aion" genannt, ist verantwortlich für das "pralle Leben"; er füllt das Fleisch und kann aus dem Körper austreten und verloren gehen, z.B. durch Bluten, Schwitzen oder das Vergießen von Tränen. Auch durch den Alterungsprozess trocknet der Körper aus und der Lebenssaft geht verloren. Das Wort "Skelett" (griechisch "skeleton") bedeutet "das Ausgetrocknete". Wenn dies geschieht, verrottet das Fleisch. Der Lebenssaft gibt dem Körper seinen Tonus, seine Spannkraft und Fülle, sein Fett und seine Kraft und ist mit Stärke, Ausstrahlungskraft und sexueller Energie verbunden. Alles, was den Lebenssaft erneuert und stärkt, wie gute und reichliche Ernährung, jede Art von Genuss, sexuelle Aktivität, ist auch Förderung des Genius - das Gegenteil wird von den Römern als "Raub am Genius" (defrudatio genii) bezeichnet. Dieser Saft ist sozusagen der Stoff des Lebens und der Fortpflanzung, während der Genius deren Geist ist.
Diesen Lebenssaft stellte man sich konzentriert insbesondere im Kopf vor und glaubte, er hänge von der Zerebrospinalflüssigkeit und dem "Knochenmark" ab. Hippokrates sprach vom Knochenmark der Wirbelsäule als dem "Aion". Kopf und Rückenmark enthalten den "Samen", der mit Mark und Gehirnsubstanz gleichgesetzt wurde. Die Bedeutung des Wortes "Aion" erhellt sich aus seiner Verwandtschaft mit "Aiolos", das "etwas, was sich bewegt" bedeutet und mit unserem "Seele" (angelsächsisch "sawol" und gothisch "saiwala") verwandt ist - es geht auf urgermanisch "saiwalo" zurück, das "aus dem See stammend, dem See zugehörig" bedeutet. Bekanntlich galten den Germanen bestimmte Seen als Aufenthaltsort der Seelen vor der Geburt und nach dem Tod, und eine alte Verwandtschaft verbindet die Vorstellungen von "Seele" mit denjenigen von "Wasser", "Feuchtigkeit" und "Saft". Da die Spanne des Lebens mit der Saftfülle des Körpers zur Neige geht, erhielt das Wort "Aion" später die Bedeutung von "Lebensalter".
|
|
|
|
|
|
|
Genius und Numen
Ähnlich wie das chinesische "Chi" ursprünglich die Bedeutung eines Dunstes besaß, der von einem überfluteten Reisfeld aufsteigt, so stellte man sich den Genius wohl ursprünglich als einen dampfartigen Geist vor, der vom Lebenssaft oder "Samen" in Rückenmark und Kopf ausgeht. Während alle Zustände und Äusserungen des wachen Ichbewußtseins Angelegenheit des "animus" sind, ist es der Genius bzw. der Daimon, der verantwortlich ist für alle spontanen, unkontrollierbaren Bewußtseinszustände und Lebensäußerungen. Für den antiken Menschen waren sie sie etwas Ähnliches wie für uns "das Unbewußte". Sie beeinflußen das Leben eines Menschen und seine Handlungen neben oder sogar gegen sein bewußtes Sein. Immer wenn es um Zustände geht, für die das bewußte Ich keine Verantwortung empfindet und die es nicht kontrollieren kann, sind in der antiken Literatur hauptsächlich Kopf und Gesicht betroffen und wird die Urheberschaft des Genius vermutet. Dazu gehören unter anderem Niesen, Erröten, Wut und Zorn, Ekstase und sexuelle Erregung, Raserei, Verrücktheit, Stolz, Scham- und Ehrgefühle. Es ist der Genius, der im Zeugungsakt explodiert und "bläst" und damit den Samen ausstösst. Wie die Römer sagten, liebt man "mit dem Mark" (amare medullitus). Dabei ist wie in vielen dieser Zustände, in denen das normale rationale Bewußtsein, das in der Brust sitzt, entthront wird und der Genius im Kopf die Kontrolle übernimmt, "das Mark in Flammen", ein inneres Feuer "isst das Mark" und man hat "Feuer in den Knochen". Es tritt ein "Brennen" des Lebenssaftes und des Marks ein, durch das eine verstärkte Aktivität des Genius entfacht wird. Die Römer verwendeten für diese Zustände die Wörter "cerebrosus" und "cerritus" (besessen, rasend, außer sich), die von "cerus, cerrus" abgeleitetet sind (siehe oben).
Beim Erröten brennt der Kopf - wir sprechen von "brennender Scham". Ein roter Kopf entsteht auch, wenn uns Wut und Zorn in den Kopf steigen - und die Augen funkeln und glühen. Etwas Ähnliches geschieht in der sexuellen Liebe und Leidenschaft, die in der Antike oft als Prozess des "Schmelzens" und der "Verflüssigung" und als "flüssig, nass" beschrieben werden. Auch die berühmte Kampfeswut der nordischen Berserker und irischen Helden (deren späte Ausläufer wohl die gefürchteten Schweizer Landsknechte waren) und die inspirierte Ekstase von Sehern, Propheten und Dichtern wird als ein "in Flammen stehen" beschrieben. Menschen mit einem starken Genius, wie Schamanen, Yogis, Helden, große und geniale Menschen, Könige und später christliche Heilige wurden deshalb oft mit einem Flammenkranz oder einer Glorie um den Kopf beschrieben.
|
|
|
|
|
|
|
Der Genius ist auch eine Kraft, die mit prophetischem Wissen begabt ist, das das bewußte Ich nicht besitzt, eine Quelle der Inspiration jenseits der gewöhnlichen Intelligenz. Der Römer sprach bei einem prophetisch oder intuitiv begabten Menschen davon, dass er Genius habe. Der Genius ist der "göttliche Helfer und Souffleur" des bewußten Ich (Onians). Griechen und Römer glaubten, dass jede Bewegung, jedes Schaudern, Zittern, Pochen und Pulsieren, Niesen, Erröten usw. ohne ersichtlichen Einfluß vom bewußten Ich Zeichen vom Genius waren, eine Botschaft oder Warnung von einem Geschehen, das sich jenseits des Horizontes des bewußten Ichs abspielte. Die Natur des betreffenden Geschehens wurde durch den Körperteil angezeigt, der sich bewegte. Das Zucken eines Augenlides konnte bedeuten, dass man die Liebste bald sehen würde; das Läuten in den Ohren, dass jemand gerade über einen sprach; ein Jucken in der Handfläche, dass man bald Geld erhalten würde.
So wurde ein Niesen entweder als prophetische Äußerung oder dann als Störung des Lebensgeistes im Kopf gedeutet - oder gar als Zeichen dafür, dass der Genius den Kopf verläßt. Wenn jemand unter den Römern nieste, sagte man "salve" (sei gegrüßt) und betete für die Abwendung der Gefahr. Die Griechen sagten beim Niesen "Zeus, rette mich". Ähnliche Gebräuche findet man bei Juden und in Indien. Das Niesen wurde als ein Nicken (numen) betrachtet, eine Bewegung, die nicht erwartet oder vom bewußten Ich kontrolliert, sondern spontaner Ausdruck des Lebensgeistes im Kopf ist. Deshalb galt das Niesen als heilig.
"Numen" ("das Nicken", oder "etwas, das nickt oder genickt wird"), ein zentraler religionswissenschaftlicher Begriff mit der Bedeutung "göttliches Wirken", der uns noch weiter beschäftigen wird, ist nur im Zusammenhang mit der geschilderten Bedeutung des Kopfes als Träger des Genius zu verstehen. Zwischen Genius und Numen gibt es einen engen Zusammenhang; der Dichter Horaz nennt Cäsars Genius "dein Numen". Der Genius manifestiert seinen Willen durch das Nicken. Das Nicken galt als etwas Mächtiges, Unwiderstehliches, als unfehlbares Versprechen, das bindend Handeln erforderte. Es war in Rom ein wichtiges Rechtssymbol - davon leitet sich her, dass man noch heute vom "Abnicken" einer Vorlage im Parlament spricht. Auch bei den Griechen war das Nicken die bindende und heilige Form des Versprechens, eine Willenskundgebung - weil der Genius im Kopf an dem Versprechen beteiligt war. Die Macht im Kopf war der Garant, der die Erfüllung sicherstellte.
|
|
|
|
|
|
|
Genius und Daimon als Totengeister
Auch der Unsterblichkeitsglaube der Römer gründet sich auf der Geniuslehre. Der Genius ist ja jener Teil des Menschen, der während des Lebens als Gott verehrt wird - ein Status, der mit Unsterblichkeit verbunden ist. Er ist der "Deus parens", dessen die Angehörigen des Verstorbenen in den "Parentalia", dem "Fest der Zeugenden", gedenken. Er lebt in einem gewissen Sinn nach dem Tod des Individuums als körperloses Wesen weiter, das manchmal als "genius" des Verstorbenen, meist jedoch als "umbra" (Schatten), "anima", oder als "Lar", "Larva" oder "Man" (Totengeist) bezeichnet wurde, weil nach dem Tod seine zeugende Kraft nicht mehr im Vordergrund steht. Das Erscheinen des Daimon in Schlangenform erklärten sich die Griechen damit, dass die Lebenssäfte des Verstorbenen aus Mark, Knochen und Gehirn nach dem Tod zusammenfließen, gerinnen und zu einer Schlange werden.
Genius und Daimon gehören jedoch, wie bereits erwähnt, im Grunde nicht dem einzelnen Individuum an, sondern stellen die kollektive Reproduktionskraft und unbewusste Identität der ganzen Familie, ursprünglich sicher des gesamten Geschlechtsverbandes, Clans oder Stammes dar. Das zeigt sich darin, dass immer nur der Genius des "pater familias" (und die "juno" der "mater familias") kultisch verehrt wurde; die Familienoberhäupter repräsentierten den Genius der ganzen Familie.
Man darf nicht vergessen, dass Vorstellungen wie Genius und Daimon ihren Ursprung in der archaischen Frühzeit der Menschheit haben, als ein individuelles Ichbewußtsein erst in Ansätzen begann, sich aus einem vorbewußten Kollektivbewußtsein ("Gruppenseele") herauszuentwickeln. Der Prozess der Ichbildung vollzog sich zunächst nur in "herausgehobenen Einzelnen", die stellvertretend für die Gruppe Träger des Bewußtseins und Vorbilder für die Bewußtseinsentwicklung aller Individuen wurden (Neumann). Jane Harrison beschreibt in "Epilegomena" die Entstehung der Vorstellung von Göttern und "Daimones" bei den Griechen aus dem kollektiven Erleben eines starken emotionalen Feldes, das bei religiösen Festen, Tänzen und Ritualen erzeugt wurde. In diesem Feld erlebte das Kollektiv sich selbst als Gott oder Gruppe von Daimones, und die als emotionales Feld erlebte und in der Ekstase wohl auch visionär geschaute Gottheit wurde, wie die Altertumswissenschaftlerin schreibt, dann vor allem auf den Anführer des Rituals projiziert, den man "daimonon agumenos", den Führer der Daimones, nannte. Er war als "hervorgehobener Einzelner" in der Lage, das unbewusste kollektive Erleben zu fokussieren und ihm Ausdruck zu verleihen.
|
|
|
|
|
|
|
Doch erst wenn wir uns vor Augen halten, dass dies alles vor dem Hintergrund einer allgemeinen numinosen Wahrnehmung der Realität geschah, können wir uns ein vollständiges Bild machen vom Wesen von Genius und Daimon. Für den archaischen Menschen, der noch kein festes Ich ausgebildet hat, fließen Innenwelt und Aussenwelt noch ineinander, und sein schwaches Ich kann in den flutenden Eindrücken, die ihn ständig zu überwältigen drohen, noch keine festen Objekte fokussieren. Für ihn ist noch alles ein "Innen" mit psychischem, begeistetem und beseeltem Charakter, eine Wirklichkeit der Numinosität, in der er ständig von Dingen, die unvorhersehbar und unkontrollierbar in seiner Aufmerksamkeit, seinem Bewußtsein auftauchen, überrascht zu werden droht. Diese unkontrollierbare, "dämonische" Realität bildet auch noch den gemeinsamen Hintergrund des antiken Weltbildes, wenn es auch im Verhältnis zu diesem "Hintergrund" zwischen Römern und Griechen gewisse Unterschiede gibt. Herbert J.Rose meint, der wesentliche Unterschied zwischen der griechischen und der römischen Art und Weise, die Welt zu betrachten, bestehe darin, dass die griechische Religion ursprünglich animistisch (Seelenglauben), die römische präanimistisch (Glaube an eine allgemeine "Kraft", die man in der Völkerkunde mit dem Südseewort "Mana" bezeichnet) sei. Das erkläre auch den mythologischen Reichtum bei den Griechen und die römische Armut an Mythen. Während nach Rose die griechische Religion vor allem vom Seelenglauben geprägt ist, steht bei den Römern die unpersönliche Manifestation des göttlichen Macht des "Mana" im Vordergrund, das Numen. Die Götter waren ursprünglich "nicht mehr als fokale Punkte von Numen, große Akkumulationen von Mana" und werden erst später zu einer Art von Personen (Rose). Die präanimistische Stufe (dieser Begriff wurde 1900 von dem englischen Religionswissenschaftler Robert R.Marett geprägt) spielte aber in der römischen Religion noch lange eine wichtige Rolle: in Form der Genius- und Numen-Lehre. Wenn man allerdings nicht nur die Hochreligion und die literarischen Zeugnisse, sondern den Volksglauben betrachtet, so ist vermutlich der Unterschied nicht mehr sehr gross. Rose und Franz Altheim weisen darauf hin, dass im römischen Weltbild das einmalige, historische festgelegte Ereignis im Vordergrund steht; sie empfanden die Besonderheit individueller geschichtlicher Augenblicke als zentral. Das ganze Wesen der römischen Götter liegt in ihrem Handeln, ihrem Wirken und Tun, sie offenbaren sich im göttlichen Akt, und der gründet sich in ihrem Hervortreten zu einer bestimmten Stunde. Das Numen meint diese historische Manifestation des Göttlichen, sein spontanes Erscheinen und Wirken. Jeder Gott besitzt sein Numen (numen Jovis, numen Cereris etc.). Genius (aber auch Daimon) sind solche Begriffe für den Handlungsaspekt des Göttlichen, in diesem Fall bezogen auf den Augenblick der Geburt bzw. der Zeugung. Die ältesten römischen Götter sind von gleicher Art. "Janus" zum Beispiel meint ursprünglich "das Gehen" und wurde dann zum Gott des Beginns einer jeden Handlung. Sein Gegenstück ist "Consus", ("das Bergen"), ist der Gott des Abschlusses jedes Tuns. Es gab sogar einen "Vagitanus" (Gott es ersten Kinderschreis), "Domiducus" (Gott des Hochzeitstags) und einen "Nodotus" (Gott der Knotenbildung im Gras- und Getreidehalm). So wie Janus und Consus regelmäßig wiederkehrende besondere Momente bezeichnen, so steht auch Genius für etwas Wiederkehrendes, nämlich die jeweils einmalige Verkörperung des Sippengeistes und Sippenlebens in einem ihrer Mitglieder, oder vielleicht vielmehr in einer Generation. Die Geburt eines Menschen wird wie ein Omen, oder "Prodigium" (Zeichen des Göttlichen) betrachtet, als numinoser Moment der göttlichen Manifestation. Wie es bei Cicero heisst, offenbaren sich Kraft und Numen einer Gottheit vor allem in Prodigien, d.h. "Geschehnissen, die durch ihren ungewöhnlichem Charakter einen Hinweis darstellten, dass das Einvernehmen mit den Göttern gestört war", wobei der Zeitpunkt ihres Auftretens das wichtigste Charakteristikum war. Prodigien spielten im römischen Privat- und öffentlichen Leben eine zentrale Rolle, viele politische Akte wurden nach den durch staatliche besoldete Berufsdeuter interpretierten Prodigien ausgerichtet. Wie Altheim betont, waren die Römer sehr nach dem Diesseits orientiert und scheinen nur die Manifestation des Göttlichen im Hier und Jetzt beachtet zu haben, während der numinose Hintergrund weitgehend unbewußt blieb. Die Griechen hingegen hätten sich viel mit der überzeitlichen Existenz von Göttern und Daimones beschäftigt, während die Offenbarung des Göttlichen in der Zeit für sie nur nebensächlichen Charakter besessen habe. Möglicherweise ist dieser Unterschied darauf zurückzuführen, dass das Ichbewusstsein des römischen Menschen bereits relativ gefestigt war, während der Grieche sich in seinem frisch erworbenen Ich durch jede Manifestation des Unbewussten (des Daimons) noch existentiell bedroht fühlen musste.
|
|
|
|
|
|
|
Der Daimon als Chthonier
Auf einen Aspekt der griechischen Religion und des Daimon müssen wir noch zu sprechen kommen, der den Zusammenhang des bisher Behandelten mit Landschaft und Orten zu beleuchten beginnt. Ähnlich wie der Römer unterschied der Grieche in der Welt des Numinosen zwei Bereiche - sie waren jedoch für ihn viel schärfer getrennt als für den Römer - : die weit entfernte Welt der olympischen Götter, die ihm wohlwollend und ungefährlich erschien, und die Welt des Chthonischen, Unterirdischen, die für ihn nah und oft bedrohlich, aber auch viel bedeutender für seinen Alltag war, weil sie direkt in sein Leben eingriff und mit diesem eng verknüpft war. Wohl wegen seiner grösseren Bedrohlichkeit wird in Griechenland auch die chthonische Natur des "Daimonischen" und seine enge Verbindung mit dem Daimon des menschlichen Unbewussten viel deutlicher als bei den Römern.
Die Griechen kannten neben den bekannten olympischen Göttern (Zeus, Hera, Ares, ) auch eine Reihe chthonischer, d.h. im Inneren der Erde hausende Götter. Wie bei allen älteren Göttern, waren ihre Konturen sehr unbestimmt. In erster Linie ist hier Gaia (oder Ge), die Erde zu nennen, wohl die chthonische Urgestalt, von der die meisten anderen Chthoniker, wie z.B. Demeter, Kore (deren Tochter) und Chthonia, abgeleitet sind. Es gab auch einen Zeus Chthonios, der mit dem Unterweltgott Hades identisch ist und der beschwichtigend auch Pluton oder Zeus Pluteus genannt wurde. Die an Landschaft, Boden und Lokalität gebundenen Kulte dieser Chthoniker sind mit einer sesshaften, ackerbauenden Kultur verbunden und gehören zum ältesten Bestand des griechischen Glaubens. Sie waren dem Volk in der Regel näher als die Verehrung der olympischen Götter, denn sie gewährten Fruchtbarkeit und Segen für den Anbau der Feldfrüchte und für das Fortleben der Familie, nahmen die Seelen der Toten in ihre Tiefe auf, und sandten Wahrsagungen von zukünftigen Ereignissen aus der Tiefe des Geisterreiches herauf.
In der Haltung der Griechen gegenüber den Chthonischen finden wir die selbe Ambivalenz wie gegenüber dem Daimon: Man benannte sie gerne mit euphemistischen Namen, die ihre grauenerregenden, ängstigenden Aspekte zugunsten ihrer segensreichen Eigenschaften verschleierten. So wurde z.B. Hades meist Pluton genannt, um ihn bei seiner Wohlstand und Erntesegen spendenden Eigenschaft zu beschwören. Man hatte den Chthonischen gegenüber ein ähnliches Gefühl, wie in Bezug auf den Daimon: Scheu und Angst, denn aus der Tiefe der Erde konnte sich jederzeit jene Kraft manifestieren, die zwar Leben brachte und das Fortleben garantierte, es aber auch jederzeit wieder zu sich nehmen konnte. Angst machte vor allem auch, dass die unvorhersehbaren und unkontrollierbaren Eingriffe dieser Kraft in das Leben jederzeit erfolgen konnten und die frisch errungene, noch gefährdete Kontrolle des bewussten Ich über Persönlichkeit und Umwelt immer wieder in Frage stellte.
|
|
|
|
|
|
|
Daimon und Heros
Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall, denn auch der Daimon (bzw. Genius) ist ein Chthonier, und es gibt viele Hinweise darauf, dass der Daimon im Menschen und die daimonische Welt unter der Erde auf eigenartige Weise identisch sein müssen. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn wir die griechische Heroenlehre betrachten. Die Heroen, zu denen es kein eigentliches römisches Gegenstück gibt, sind Verstorbene, die sich bereits während ihrer Lebenszeit durch ihren Daimon als "hervorgehobene Einzelne" hervorgetan haben und die nach ihrem Tod als "mächtige Tote" (Nilsson) zu "Heroen" werden, die eine Art Halbgötter darstellen. Wie Nilsson schreibt, beruhte Heroisierung nicht auf Heiligkeit oder Verdiensten während des Lebens, sondern auf einer besonderen, dem Toten anhaftende Kraft, die auch bösartig sein konnte. Auch hier ist es wieder das Außerordentliche, Unberechenbare, Unheimliche, mit anderen Worten der Daimon, der den Heros ausmacht. Die Macht des Heros ist an sein Grab gebunden und wirkt fort, aber nur lokal im Umkreis des Grabes und für "seine" Familie, Gruppe, Stadt usw. Überall in Griechenland gab es solche Heroengräber, die eine zentrale Rolle im altgriechischen Volksglauben spielten. Der Glaube an die im Leibe des Toten fortwirkende Macht übertrug diese auch auf den Grabstein, von dem man annahm, dass er die Macht des Daimon enthalten konnte. Das Hauptereignis ihres Kultes war das kultische Mahl zu Ehren des Heros. Vom kultisch besänftigten Heros wurden Fruchtbarkeit der Felder, Heilungen, Geschäfts- und Kriegsglück und mantische Weisungen erwartet. Wenn ein Grieche an einem Heroengrab vorbeikam, verstummte er, um den "Mächtigen" (Kreitton) nicht zu stören.
|
|
|
|
|
|
|
Eine Art von Heroen sind die "eponymen Heroen", nach denen ganze Geschlechter benannt sind, wie z.B. die mythischen Könige von Athen - Kekrops, nach dem das Geschlecht der Kekropiden, oder Erichthonios, von dem die Erichthoniden ihren Namen haben (Harrison). Sie werden als Schlangen-Daimones, als Wesen mit menschlichem Oberkörper und dem Unterleib einer Schlange, betrachtet und dargestellt. In neu angelegten Städten wird meist der Gründer zum "Heros Ktistes" (Gründer-Heros), der oft auf dem Marktplatz bestattet ist. Die zehn Phylen (Stämme), die nach der Reform des Kleisthenes im Jahre 510 in Athen die alten Geschlechterverbände ersetzten, waren nach je einem Heros benannt; auf dem Athener Marktplatz wurden 10 Heroengräber angelegt. Auch blitzgetroffene Menschen wurden heroisiert.
Die Heroen, mit anderen Worten, verkörperten den Genius der betreffenden Geschlechter oder Gruppen; wieder geht es nicht um persönliche Unsterblichkeit, sondern um die Kraft oder den Geist, der die ewige Erneuerung des Lebens durch Wiedergeburt und das ewige Fortleben der Gruppe verkörperte.
|
|
|
|
|
|
|
Daimones und Heroen wurden von Pythagoräern und dann auch von Plato als Zwischenstufen zwischen den Göttern und dem Menschen betrachtet (Burkert, Lore). Nach Hesiod (ca. 700 v.Chr.) wurden die Geschlechter der ersten Menschenzeitalter zu Daimones (Rohde). In seiner "Erzählung von den fünf Menschengeschlechtern" im Buch "Werke und Tage" kann man lesen, dass die Götter am Anfang das Goldene Geschlecht geschaffen hätten, das ohne Alter, Krankheit und Sorge gelebt habe; die Menschen dieses Geschlechts wurden nach ihrem Tode zu mächtigen Daimones, die in Wolken gehüllt unsichtbar über die Menschen wachten. Das darauf folgende silberne Geschlecht war übermütig und hatte keinen Respekt vor den Göttern: Es wurde deshalb vertilgt und wurde zu unterirdischen Daimones, ebenfalls mächtig und verehrt von den Menschen, jedoch weniger als diejenigen des goldenen Zeitalters. Die Angehörigen des ehernen Geschlechtes waren gewalttätig und harten Sinnes; sie vernichteten sich gegenseitig und kamen in den Hades. Das nachfolgende Geschlecht der Heroen, das um Theben und Troia kämpfte und aus den Erzählungen Homers bekannt ist, war gerechter und besser. Sie schieden aus dem Leben, ohne zu sterben, d.h. wurden mit Leib und Seele entrückt und wohnen seitdem auf den Inseln der Seligen. Das Geschlecht des eisernen Zeitalters ist das der sterblichen Zeitgenossen Hesiods. Es wird von Mühe und Sorgen, Faustrecht, Feindschaft und Konkurrenz aller gegen alle beherrscht. Goldenes und silbernes Geschlecht werden also zu Daimones, die zusammen mit den Heroen, zu denen die Menschen des vierten Zeitalters geworden sind, die unsichtbare Welt des antiken Griechenland bevölkern und die Menschen bewachen und beeinflussen. Das Interessante an Hesiods Darstellung ist, dass nur die einst Verstorbenen zu Geistern werden, die in der heutigen Welt mächtig wirken, nicht aber die zeitgenössischen Toten.
|
|
|
|
|
|
|
Der Genius und die Kraftwesen der Traumzeit
Diese Eigenschaften der Daimones und Heroen lassen es als berechtigt erscheinen, einen Bezug zwischen ihnen (bzw. den Genien der Römer) und den "Ahnen der Traumzeit" der australischen Aborigines herzustellen. Die australischen Ureinwohner führen ihre Existenz auf mythische, halb göttliche, halb menschliche Wesen einer überzeitlichen Urzeit zurück. Diese Geister-Ahnen der jeweiligen Clans haben die Landschaft mit ihrem eigenen Leib geschaffen, indem sie in der "Traumzeit" zu Felsen, Quellen, Bäumen, Bergen und anderen Teilen der Landschaft wurden. Die Identität eines Clansmitgliedes der Aborigines ist eine kollektive und besteht in der Teilhabe an einem dieser Kraftwesen, das gleichzeitig als Ortsgeist in der Erde am mythischen Ursprungsort des Clans und als als Seelenteil in jedem einzelnen Clanmitglied lebt. Es kann auch als "Totemtier" in der Gestalt eines Känguruhs oder einer Eidechse erscheinen und stellvertretend in "Kraftobjekten", den "Dschuringas", bemalten Steinen oder Holzstücken, gegenwärtig sein.
|
|
|
|
|
|
|
Der Genius loci
Personalgenius und Ortsgenius (Genius loci) sind somit letztlich gar nicht zwei verschiedene Dinge, als die sie in der Fachliteratur erscheinen, sondern bilden ein einheitliches Phänomen, das in zwei unterschiedlichen Aspekten zutage tritt. Der Genius ist eine Art Gruppengeist oder eine Gruppenseele, die alle Individuen einer Familie oder Sippe einerseits miteinander und mit den verstorbenen Mitgliedern, den Ahnen, auf der anderen Seite mit dem Ursprungs- und "Wohnort" des Gruppengeistes verbindet. Der Personalgenius, der das Chthonische, Unterirdische im Menschen darstellt, ist identisch oder verbunden mit der Unterwelt der Erde, mit jenem verborgenen Pool des Mana, der zeugenden Lebenskraft der Vorfahren, aus dem diese in den Kreislauf der Wiedergeburten eingespeist wird und in den sie immer wieder zurückkehrt. In meinem Buch "Unsere Seele kann fliegen" habe ich diese Kraft in moderne Begriffe übersetzt die "stammeseigenen morphogenetischen Felder" genannt.
Von dort möchte ich weiter zitieren: "In Ngama in Zentralaustralien liegt eine Felsgruppe, in der man verschiedene hundeähnliche Formen sehen kann: sie war nach der einheimischen Mythologie Wohnort der ersten Familie wilder Hunde und wird als magisches Hervorbringungszentrum der Spezies betrachtet, wo die Eingeborenen Zeremonien zur Steigerung der Hundepopulation verrichten. Dieselbe Funktion haben unsere Kultorte für menschliche Stämme oder Stammesverbände: sie sind der zentrale Quell der Lebenskraft aller, die vom Ahn abstammen, die Wurzel der Herkunft. Wenn man feststellt, dass die Rituale, die mit solchen Orten verbunden sind, Fruchtbarkeitsrituale sind, darf man nicht vergessen, dass die Kraft, die hier entspringt und die in den Ritualen jährlich erneuert werden muß, auf keinen Fall plump sexuell verstanden werden darf. Dieselbe sexuelle Energie, die in diesen "Points d'amour" (Robert Charroux) wohnt, ist auch Geist und Seele, das Wesen des Ahns und des Stamms sowie der Landschaft der Umgebung. Die Orte sind auch Quell der Inspiration, Zugang zur kollektiven Erinnerung, zur Information, die im Stammesarchetyp wohnt, sind auch Orakel".
|
|
|
|
|
|
|
"Steine und Stöcke" - die Charakterisierung des englischen Archäologen Sir Arthur Evans für die wesentlichsten Elemente der minoischen Kultur im frühen Griechenland - verkörpern in der archaischen Landschaft solche Mana-Sitze, und nach unseren Erläuterungen über die Bedeutung des Kopfes als Sitz des Genius sehen wir, dass es kein Zufall ist, dass Felsen, Baumstümpfe, Pfähle und Menhire als Sitze des "Kopfgeistes" später oft mit Köpfen versehen oder als Penis gestaltet wurden, wurde doch dessen "Kopf" gleichermaßen zu dem Haupt der menschlichen Gestalt in Beziehung gesetzt. Das prominenteste Beispiel im alten Griechenland ist der "Kopfgott", Seelenführer und Beschützer der Wege Hermes, dessen steinerne Darstellungen als geflügelter Phallus oder Kopf in der griechischen Landschaft der Antike überall anzutreffen waren. Von der geomantischen Bedeutung des Zusammenhanges zwischen Kopf und Genius zeugen auch die vielen Kopf-Orte, vom römischen Kapitol (Capitolium=Ort des Kopfes) über das Jerusalemer Golgatha bis zum White Hill in London, wo der Kopf des keltischen Unterweltgottes Bran begraben sein und das Land beschützen soll.
Vor diesem Hintergrund sind auch die spärlichen Zeugnisse zu sehen, die wir von römischen Autoren über den Genius loci haben. Wie Menschen und Gruppen von Menschen - so gab es z.B. den "genius populi Romani" (des römischen Volkes) - , so schrieb der Römer auch jedem Ort der natürlichen Landschaft einen Genius zu. Es gibt den "genius montis" (Genius des Berges), "genius valli, fontis, fluminis" (Genius des Tales, der Quelle, des Flusses), sogar nur einen "genius huius loci montis" (dieser Stelle des Berges) (siehe Abbildung aus Herkulaneum). Aber auch alle vom Menschen geschaffenen örtlichen Strukturen besaßen für den Römer ihren Genius loci als Schutzgeist. Dazu schreibt der Schriftsteller Prudentius: "Auch den Toren pflegt ihr einen Genius zuzuschreiben, den Häusern, den Thermen, den Ställen und für jeden Ort und alle Glieder der Stadt viele tausend Genien anzunehmen, so dass kein Winkel des ihm eigenen Schattengeistes entbehre" (Birt). So findet man "genius theatri, thermarum, horrei (Kornspeicher), stabuli, curiae" etc. Die Zueignung eines Ortes oder Gebäudes an einen Genius verlieh Schutz gegen Unbill und Verunreinigung. Auch Provinzen, Dörfer, Städte und Gemeinden haben ihren Genius loci: "genius vici, oppidi, municipi, Genius Cartagini (Karthago), Lugduni (Lyon), genius urbis Roma (Stadt Rom). Manchmal wurden diese Genien auf den Denkmälern oder in der Literatur mit bestimmten Göttern identifiziert (Apollo, Mars, Herkules etc.), die "deus patrius" (väterlicher Gott) und "genius coloniae" (Genius der Kolonie, Siedlung) sind, oft aber heissen sie ohne nähere Kennzeichnung einfach"genius huius loci" (Genius dieser Stätte). Über Orte, an denen ein Genius wohnte, konnte der Römer sagen "numen inest" (darin wohnt ein Geist, das göttliche Numen), wie der Dichter Ovid in den "Fasti" (III,296-7) über den Aventinhügel. Die griechische Entsprechung dazu wäre "daimonios ho topos" (Rose).
|
|
|
|
|
|
|
Tempel wurden vielen Lokalgenien erbaut, aber nur denen von allgemeiner Bedeutung. Bei diesen fehlte oft sogar ein schriftlicher Hinweis; die Gegenwart eines Genius wurde dann nur durch das Bild einer Schlange angedeutet, das übliche Symbol des Genius loci. In den Häusern hielten die Römer meist lebende Schlangen, die als identisch mit den Ortsgenien galten und die Personalgenien behüteten; der Tod einer solchen Hausschlange galt als böses Omen.
Vom Weiterleben des Genius loci-Konzeptes - und von der Kenntnis der antiken Diskussionen über das Wesen von Genius und Daimon - in späteren Jahrhunderten, vor allem in der Tradition des Humanismus, zeugt der St.Galler Humanist und Reformator Vadian, der 1518 nach jahrhundertelangem amtlichem Verbot als erster den Berg Pilatus in der Nähe von Luzern bestieg, um den berühmten "verwünschten See" zu besichtigen und einen persönlichen Augenschein am Ort vieler alter Sagen zu nehmen. In seinem Bericht darüber schrieb er, dass gewisse Orte sich durch ein "numen aliquod naturae" (ein gewisses "numen" der Natur) auszeichneten - er verwendete auch die Begriffe "numen loci" und "genius loci" - das er natürlichen, nicht übernatürlichen Ursachen zuschrieb, während sein Kollege Gesner an das Wirken eines Geistes oder Dämonen glaubte - mit der Begründung, die Natur tue nichts Plötzliches und Unangekündigtes, und kleinste Ursachen könnten keine großen Wirkungen haben. Dieses "numen naturae" stellte sich Vadian als eine Art Kraftstoff-Konzentration vor (Schmid).
nach oben
|
|
|
|
|
|
|
3. GEOMANTIE – ORTE DER KRAFT
Eine Konzeption von den unsichtbaren Strukturen von Raum und Landschaft jenseits von Physik und Radiästhesie. Von Marco Bischof, 1990
Veröffentlicht in der Zeitschrift „Wetter-Boden-Mensch“, 2/1990
Dank der Radiästhesie ist die Vorstellung von unsichtbaren energetischen Raumstrukturen und Standorteinflüssen bis in unsere Zeit gerettet worden. Aus verschiedenen Gründen erscheint dem Autor aber die radiästhetische Konzeption der Gitternetze unbefriedigend und zu sehr einem physikalischen Denken verhaftet. Er versucht in seinen Forschungen zu einer umfassenderen, ganzheitlichen Auffassung über die unsichtbaren Strukturen von Raum und Landschaft zu gelangen, die sowohl die Forschungen über die traditionelle Geomantie der alten Kulturen und "Naturvölker" wie auch die Erkenntnisse der neuesten Physik einbezieht.
Die Mythen verschiedenster Völker berichten von einem heute "versunkenen", nicht immer alltäglich zugänglichen "Land" - dem, was wir Paradies nennen -, dessen Landschaft von einem eigenartigen, von innen kommenden Leuchten erfüllt und von einer unirdischen Lebendigkeit ist. Diese "himmlische Erde" ist eine andere Dimension der Landschaft, in der wir leben, ist gleichsam "hinter" dieser oder in dieser verborgen. Früheren Kulturen waren Erde und Landschaft noch "heilig", weil transparent für diese "andere Welt". Ohne Ausnahme berichten die Mythen von einer Art Sündenfall, einer Austreibung der Menscheit aus dem Paradies durch eigene Schuld. Der Kulturprozeß mit seiner zunehmenden Unterwerfung von Natur und Landschaft unter menschlichen Gestaltungswillen hat eine immer größere Entfremdung des Menschen von der Natur in der Umwelt, aber auch in ihm selbst mit sich gebracht; das ist die Bedeutung von "Sünde" (= Sonderung, Trennung).
Doch der Mensch hat eine Möglichkeit, mit dem nicht eigentlich verlorenen, nur "versunkenen" Paradies Kontakt aufzunehmen, denn es handelt sich im Grunde eher um einen Bewußtseinszustand als ein geografisch lokalisiertes "Land". Ob die Menschheit nun tatsächlich einmal in diesem Zustand gelebt hat oder nicht, die zumindest zeitweilige Rückverbindung mit diesem Zustand ist für den Einzelmenschen und für die ganzen Gesellschaften und Kulturen lebenswichtig. Frühere Kulturen waren sogar auf der Grundlage dieser Rückverbindung aufgebaut.
|
|
|
|
|
|
|
Schamanen und andere Menschen mit der Befähigung zum "Seelenreisen" unternahmen immer wieder Ausflüge in diese Welt, in der "alles zum ersten Mal geschehen ist". Die buddhistische Meditationspraxis hat ebenso zum Ziel, den Meditierenden in jenen Zustand zurückzuführen, in dem er die Welt so erlebt, wie sie in der Frische des Anfangs war, bevor die Enkulturationsprozesse einsetzten, in die Welt dessen, was man heute die "primäre Wahrnehmungen" nennt. Heiler versetzen sich ebenfalls in diesen Zustand der Gedankenfreiheit und größtmöglichen Unbelastetheit und Entspannung, weil hier eine zutiefst befreiende und heilende Energie frei wird, die sich auf den Patienten übertragen läßt.
Auch die moderne Physik hat Konzeptionen entwickelt, die für die Existenz einer solchen Dimension der Wirklichkeit sprechen. Ich möchte nur die "holografische Theorie der Wirklichkeit" des Einstein-Schülers David BOHM erwähnen. Sie spricht davon, daß es neben der "expliziten Dimension" der von unseren Sinnen wahrgenommenen und physikalisch meßbaren Objektwelt eine so genannte "implizite Dimension" der Wirklichkeit gibt, die der Wirklichkeit entspricht, die wir in der "primären Wahrnehmung" wahrnehmen. Bevor unser Gehirn (nachgewiesenermaßen) aus dem was unsere Sinne aufnehmen, die Welt der Gegenstände konstruiert, nehmen wir nämlich bloß eine Welt von ineinander verwobenen Schwingungen wahr, in der wie in einem holografischen Bild keinerlei Gegenstände erkennbar sind.
Auf ähnliche Weise erlebt jemand, der unter dem Einfluß bestimmter "psychedelischer" Drogen steht, seine Umgebung: die Gegenstände fangen an zu leben und sich in Schwingungsgebilde aufzulösen, was sie ja nach den Erkenntnissen der modemen Physik auch sind, und leuchten wie von innen heraus
|
|
|
|
|
|
|
Etwa nehmen auch Seelenreisende die Landschaft auf ihren außerkörper-lichen Ausflügen wahr. Die "leuchtenden Pfade" und "Feenstraßen", von denen in der Geomantie und in den Sagen verschiedenster Völker die Rede ist, entstammen den Berichten zurückgekehrter Seelenreisender ebenso wie die verschiedenen eigenartigen, oft auch als leuchtend beschriebenen Wesen, die die Landschaft in vielen Volkssagen an bestimmten Stellen bevölkern.
Dieses Paradies könnte man auch als eine Art "Modellvorstellung" bezeichnen, wie sie die moderne Naturwissenschaft kennt. In diesem Land findet nämlich, worin wir es in der Ausdrucksweise der JUNG'schen Psychologie sagen wollen, die "Begegnung mit dem Selbst" statt. Die Landschaft des Paradieses stellt das Urbild einer Landschaft dar, wie es irgendwo im Unbewußtsein jedes Menschen gespeichert ist. Der Seelenreisende hat hier auch Begegnungen mit Guru-artigen Wesen, die ihm alle Arten von Einsichten, von belanglosen Informationen bis zu erschütternden Einweihungserlebnissen vermitteln. Diese Wesen erlebt er oft als den Inbegriff eines spirituell hochentwickelten Menschen, als "idealen Menschen".
Alle diese Erfahrungen im "anderen Land" der Seelenreise sind immer wieder in der Menschheitsgeschichte zu den Inspirationen und Vorbildern für die Gestaltung von Umwelt, Gesellschaft, privater Lebensführung und allen Arten von Erfindungen geworden.
Alles irdische Schaffen des Menschen wurde in den traditionellen Gesellschaften am Maßstab dieser "himmlischen Erde" gemessen und sollte eine Spiegelung davon sein. Überlieferte Traditionen und Gesetze mußten immer wieder erneuert und vor der Erstarrung bewahrt werden durch die direkte Einholung einer Vision aus diesem lebendigen Speicher archetypischer Vorbilder, sonst drohten sie zu "toten Buchstaben" zu werden (besonders nachdem man mit ihrer schriftlichen Aufzeichnung begonnen hatte).
Man könnte also durchaus die verschiedenen Kulturen nach ihrem Verhältnis zu dieser paradiesischen Dimension beurteilen. Alle Gesellschaften leben natürlich in einem Spannungsfeld zwischen "Paradies" und "gefallener Welt" und müssen mit der Diskrepanz leben. Die Geomantie operiert genau in diesem Spannungsfeld. Ihre Aufgabe ist es einerseits, den Zugang zu der lebenswichtigen, sinnvermittelnden und energiespendenden Paradies-Dimension zu sichern, weil ohne diese ständige oder wenigstens periodische Rückverbindung Mensch und Gesellschaft von ihren eigenen seelischen und geistigen Kraft- und Inspirationsquellen abgeschnitten sind.
|
|
|
|
|
|
|
Auf der anderen Seite hat sich der Mensch durch dieselben Tiefendimensionen der Wirksamkeit schon immer bedroht gefühlt: "Chaos" und Wildheit drohen die mühsam errungene Ordnung der menschlichen Kultur immer wieder zu verschlingen und zu zerstören. Die Geomantie hat daher auch die Aufgabe, die menschliche Gesellschaft vor derselben "Energie", auf die sie so sehr angewiesen ist, zu schützen.
Mit Seßhaftigkeit und hochkultureller Entwicklung ist die einst enge Verbindung zum "Paradies" immer weiter in die Ferne gerückt. Die Fähigkeit zur Vision ist immer schwächer geworden. Besonders in der Neuzeit, seitdem sich das "moderne" wissenschaftliche Denken entwickelt hat, ist sie regelrecht entwertet worden; der amerikanische Kulturkritiker ROSZAK spricht von einem "Krieg gegen die Imagination". Heute befinden wir uns wahrscheinlich im Endstadium dieser Entwicklung, indem wir die Existenz der Paradies-Dimension von Welt und Landschaft gänzlich leugnen. Wir haben alles beinahe vollkommen verdinglicht und entseelt und finden uns nun in einer verschmutzten, erstarrten, leblosen Welt wieder, in der wir nicht zuhause sein können - natürlich ist sie nur ein Spiegelbild des Zustandes, in dem wir uns selbst befinden.
Wir brauchen aber zur Heilung dieses Zustandes mehr als nur die radiästhetische und physikalische Anerkennung von Erdstrahlen. Die Gitternetze und alles andere sind auch wieder nur objektive, verdinglichte Vorstellungen von etwas, was man sich als vollkommen unabhängig vom Menschen existierend vorstellt. Wir müssen jetzt das, was in der Physik in Bezug auf die "Einbeziehung des Beobachters" diskutiert wird, auch in dieses Gebiet hineinbringen.
Wir brauchen eine "Wiederverzauberung" der Landschaft, und dabei geht es um weit mehr als bloße Fantasie - nämlich um die wahre Imagination. Diese ist nach Henry CORBIN das Wahrnehmungsorgan für die "Welt des Imaginalen", die zusammen mit der eigentlichen "Paradieswelt" des Archetypischen die unsichtbare Dimension von Wirklichkeit und Landschaft bildet. CORBIN versichert uns, auf die Autorität der persischen Illuminaten gestützt, daß es sich bei diesen beiden neben der Objektwelt existierenden Dimensionen der Wirklichkeit um etwas handelt, das ebenso real wie diese ist, aber seine eigenen Gesetze besitzt. Im Gegensatz zur Objektwelt aber, die dies fast nicht tut, beziehen diese Welten "den Beobachter", d. h. die seelische und geistige Wirklichkeit des Menschen mit ein.
|
|
|
|
|
|
|